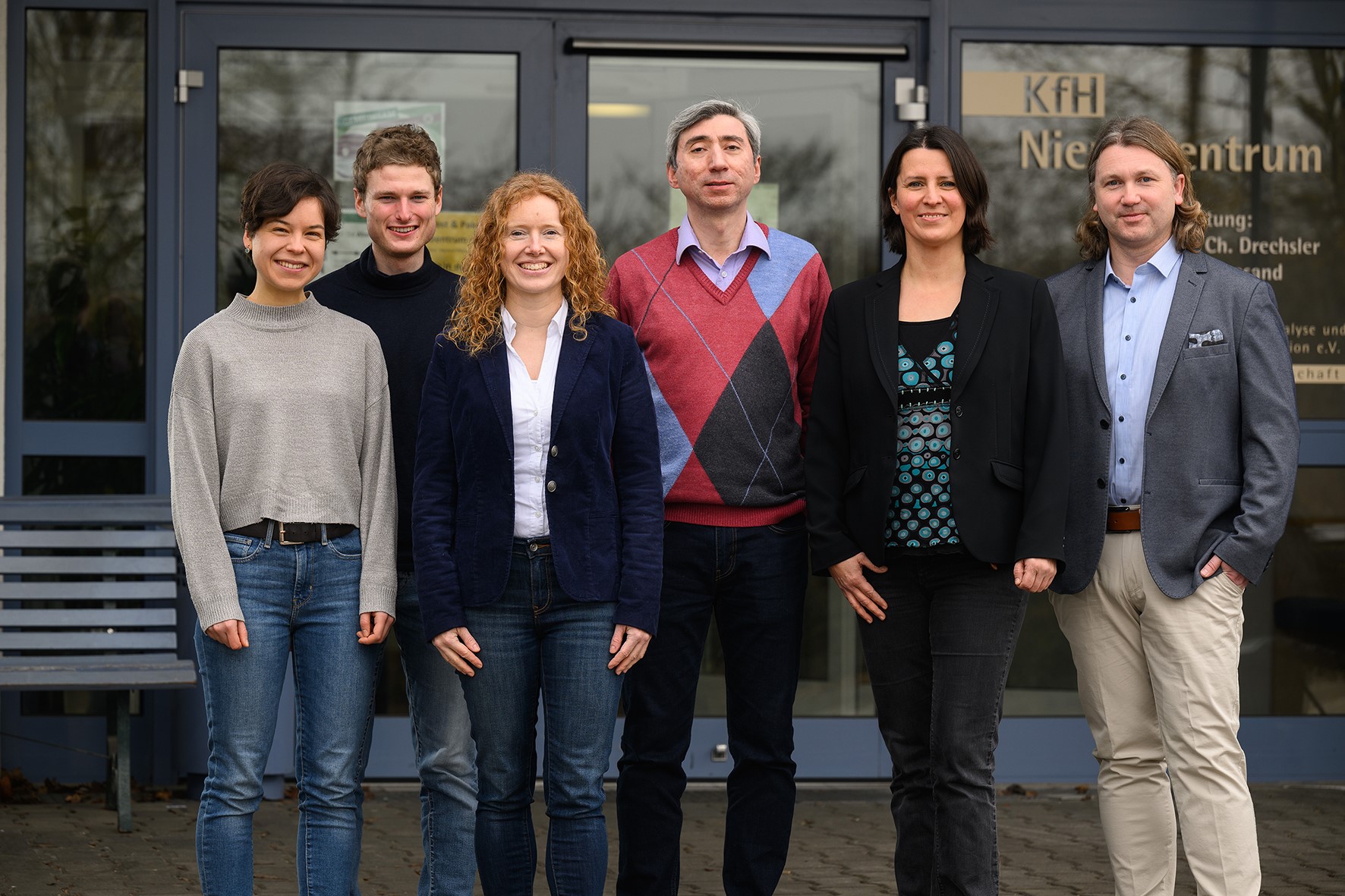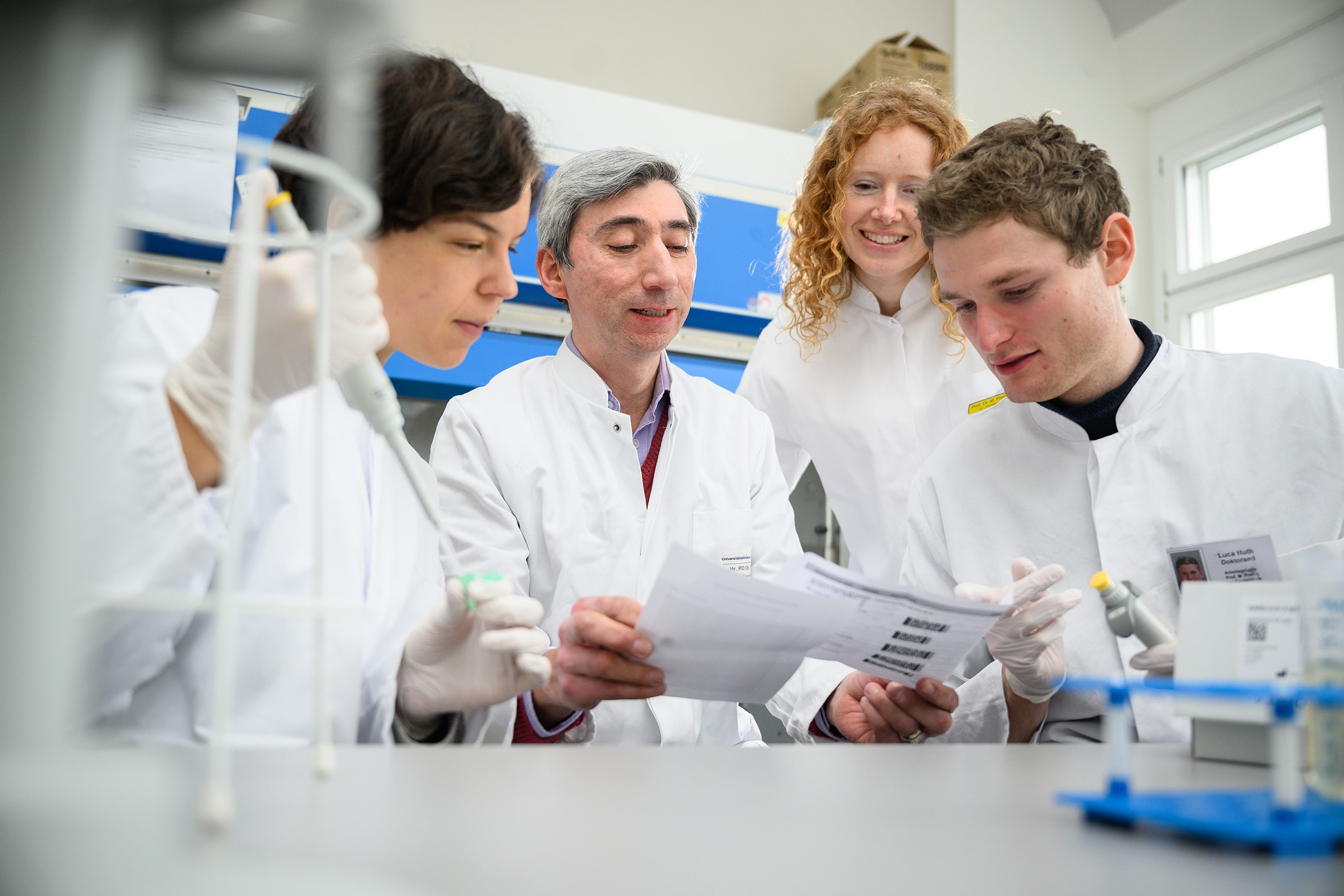Aktuell warten in Deutschland mehr als 8.700 Menschen auf ein dringend benötigtes Spenderorgan; 2021 sind 873 Menschen auf der Warteliste gestorben. Deutschland ist derzeit Schlusslicht bei den Organspenden in Europa. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) meldet erneut einen Rückgang der Zahl von Organspenderinnen und Organspendern für das Jahr 2022 um 6,9 Prozent.
Um das Thema Organspende wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, haben sich jetzt die sechs bayerischen Universitätsklinika zu einer einzigartigen Initiative zusammengeschlossen: „UNIty Bayern – Bayerische Uniklinika pro Organspende“. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek unterstützt dieses lebenswichtige Engagement: „Die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung steht der Organ- und Gewebespende grundsätzlich positiv gegenüber – das ist ein wichtiges Signal. Aber zu wenige Menschen in Deutschland haben einer Umfrage zufolge auch einen Organspendeausweis oder eine Patientenverfügung, die sich mit der Organ- und Gewebespende befasst“, erklärt Holetschek. „Mein Ziel ist es, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. Deswegen unterstütze ich die Initiative aller bayerischen Uniklinika, die ebenso wie etwa das Bündnis Organspende Bayern oder die im vergangenen Jahr gestartete Kampagne ,Du entscheidest! Organspende? Deine Wahl‘ einen wichtigen Beitrag leisten kann, um für das Thema zu sensibilisieren.“
„UNIty Bayern“ – Stimmen aus den bayerischen Universitätsklinika
Universitätsklinikum Würzburg
Auch das Universitätsklinikum Würzburg unterstützt die Initiative „UNIty Bayern“: „Ein Rückgang von Spenderorganen bedeutet eine Verlängerung der Wartezeit. Mit einem Organspendeausweis kann die individuelle Entscheidung dokumentiert werden und natürlich auch im engen Angehörigenkreis besprochen werden“, betont Prof. Dr. Jens Maschmann, Ärztlicher Direktor der unterfränkischen Uniklinik. An der Würzburger Uniklinik werden hauptsächlich Nieren und Lebern, aber auch Bauchspeicheldrüsen transplantiert.
Universitätsklinikum Augsburg
„Das gemeinsame Ziel unserer Initiative und die gemeinsame Aufgabe der Universitätsmedizin ist es, die Bevölkerung aufzuklären und an die Menschen zu appellieren, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen, um selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen und diese auch in einem Organspendeausweis zu dokumentieren“, sagt Prof. Dr. Matthias Anthuber, Direktor der Klinik für Allgemein- Viszeral und Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Augsburg. „Die aktuelle Situation ist für unsere Patientinnen und Patienten nicht akzeptabel. Aufgrund der geringen Organspendezahlen haben sie hierzulande deutlich längere Wartezeiten und damit auch eine deutlich schlechtere Prognose als Betroffene in anderen Ländern. Daran muss sich etwas ändern!“, sagt Oberarzt Dr. Florian Sommer vom Transplantationszentrum des Universitätsklinikums Augsburg.
Uniklinikum Erlangen
„Mit der Aktion ,UNIty Bayern‘ wollen wir alle Menschen ermutigen, jetzt mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin, mit Eltern, Kindern und Angehörigen über das Thema Organspende zu sprechen. Denn eines ist klar: Der Patientenwille zur Organspende ist in Deutschland leider noch immer viel zu selten bekannt. Angehörige müssen daher oft im mutmaßlichen Willen entscheiden. Daran kann sich nur durch Aufklärung etwas ändern. Jeder sollte bedenken, dass es wahrscheinlicher ist, selber auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein, als Organspenderin oder Organspender werden zu können. Organspende geht uns alle an“, sagt Prof. Dr. Dr. h. c. Heinrich Iro, Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Erlangen.
LMU Klinikum München
„Die bisherigen Änderungen der gesetzlichen Regelung zur Organspende haben nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Wir benötigen in Deutschland dringend die Widerspruchregelung, die davon ausgeht, dass alle Bürgerinnen und Bürger mit der Organspende einverstanden sind, es sei denn sie haben zu Lebzeiten widersprochen. Alle unsere Nachbarländer haben diese Regelung – und im Schnitt mehr als doppelt so viele Spenderinnen und Spender pro eine Million Menschen wie Deutschland“, sagt Prof. Dr. Bruno Meiser, Leiter des Transplantationszentrums am LMU Klinikum München, dem größten in Bayern und zweitgrößten in Deutschland mit Programmen für Herz, Lunge, Leber, Niere, Dünndarm und Pankreas. „Es sind die Gesunden in Politik und Gesellschaft, die nun eine Entscheidung für die Kränksten in unserem Land treffen müssen – von denen täglich zwei bis drei sterben müssen, während sie auf eine Organspende warten“, fordert Prof. Dr. Markus M. Lerch, Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor LMU Klinikum.
Universitätsklinikum rechts der Isar (Technische Universität München)
„Im Universitätsklinikum rechts der Isar erleben wir immer wieder, dass eine Organspende nicht nur Leben retten, sondern auch die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten erheblich verbessern kann“, sagt Dr. Martin Siess, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums rechts der Isar. „Viele unserer Patientinnen und Patienten warten leider sehr lange auf ein Spenderorgan von Verstorbenen – einige von ihnen auch vergebens. Manche haben Glück und finden Lebendspenderinnen und -spender in der Familie oder im Bekanntenkreis. Deshalb haben wir uns am Transplantationszentrum TransplanTUM zusätzlich auf Lebendspenden bei Nieren spezialisiert. Damit können wir vielen Dialysepatientinnen und -patienten helfen und einige Betroffene sogar vor der Dialyse bewahren“, erklärt Prof. Dr. Volker Aßfalg, Leiter der Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum rechts der Isar.
Universitätsklinikum Regensburg
Prof. Dr. Bernhard Banas, Leiter des Universitären Transplantationszentrums Regensburg sowie der Ethikkommission Deutsche Transplantationsgesellschaft e.V.: „Es gibt in Deutschland durchaus eine hohe Bereitschaft zur Organspende, nämlich etwa 80 Prozent der Bevölkerung. Wir transplantieren täglich Organe aus sieben anderen Ländern im Eurotransplant-Verbund. Alle diese Länder haben eine Widerspruchsregelung eingeführt, die auch in Deutschland bewirken könnte, die Spendebereitschaft in tatsächlichen Spenden zu realisieren.“
Weiterführende Anfragen und Auskünfte gerne über: presse@organspendelauf.de
Gemeinsame Medieninformation der Bayerischen Universitätsklinika vom 28.02.2023