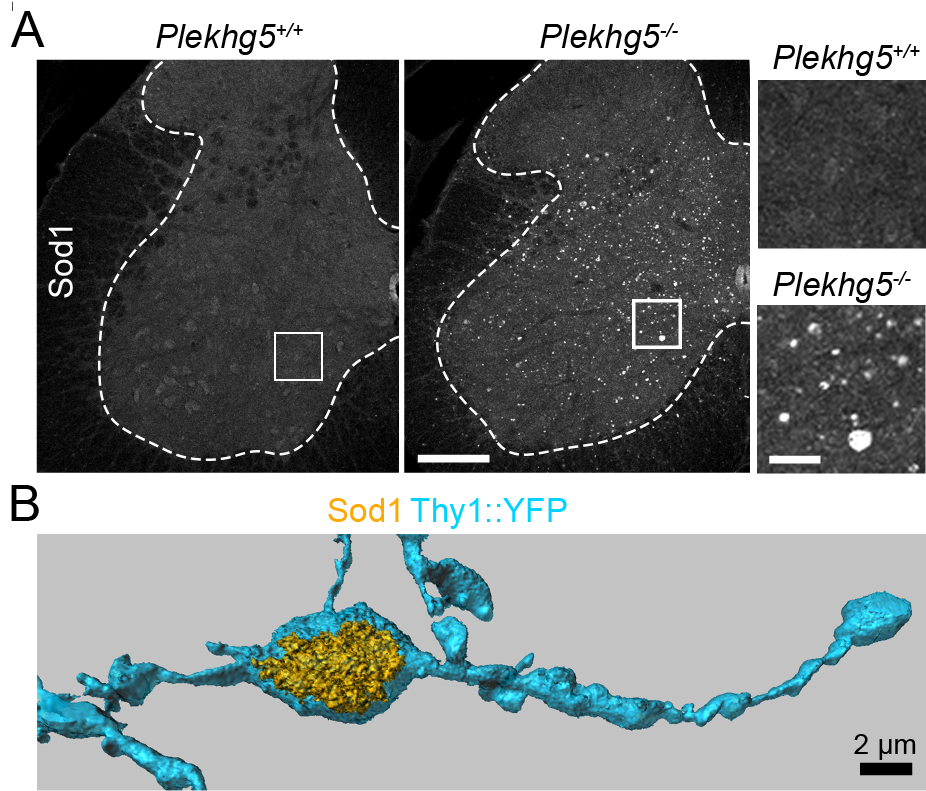Würzburg. „Es war eine sehr intensive Zeit, aber auch eine ganz besondere Erfahrung“, sagt Prof. Dr. Martin Fassnacht über seine Tour als „Visiting Professor“ durch das Vereinigte Königreich (UK) vom 1. bis 11. März. Die Society for Endocrinology (SfE) hatte den Leiter des Lehrstuhls für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) eingeladen, fünf endokrinologische Zentren in Großbritannien - Glasgow, Manchester, Birmingham, Oxford und London - zu besuchen und abschließend einen Plenarvortrag auf dem Kongress der British Endocrine Society (SfE BES 2025) in Harrogate zu halten. Diese Auszeichnung ist zugleich der Hauptpreis der endokrinologischen Fachgesellschaft. Der mit 8.000 Euro dotierte „Clinical Endocrinology Journal Foundation Visiting Professor Award“ wird einmal im Jahr an einen herausragenden ausländischen Endokrinologen verliehen. Eine aktive Bewerbung ist nicht möglich, eine Jury wählt aus.
Kontakte und Kollaborationen
Neben dem Preisgeld gewann Martin Fassnacht auf seiner Reise viele Kontakte. „Ich habe sehr viele interessante Forscherinnen und Forscher, darunter auch zahlreiche Nachwuchskräfte, neu oder besser kennen gelernt und die Kontakte zu den jeweiligen Zentren ausgebaut“. berichtet Martin Fassnacht. Er ist überzeugt, dass sich aus seinem Besuch das eine oder andere gemeinsame Forschungsprojekt entwickeln wird. An jedem Standort gab es jeweils ein wissenschaftliches Symposium, bei dem Martin Fassnacht einen seiner Vorträge zu unterschiedlichen Aspekten von Nebennierentumoren hielt, den sich die Zentren jeweils auswählen durften. „Zusätzlich gab es Beiträge der lokalen Wissenschaftler und Kliniker sowie anschließend immer auch Gelegenheit zu Gruppen- und Einzelgesprächen, in denen es entweder um die Beratung von Nachwuchswissenschaftlern oder um die Diskussion von Forschungsprojekten ging“, so Fassnacht.
Der Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie wurde Anfang 2014 zum Professor an der Universität Würzburg ernannt. Seine Forschungsschwerpunkte sind endokrine Tumoren, Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen sowie Adipositas. Er leitete mehrere nationale und internationale Leitliniengremien, war Hauptprüfer mehrerer Phase II und III Studien zu Nebennierentumoren und ist Autor von mehr als 300 Publikationen.
Plenarvortrag zum Management des Phäochromozytoms und Paraganglioms
In seinem Plenarvortrag beim SfE BES 2025 am 10. März gab Martin Fassnacht ein Update zur Behandlung des Phäochromozytoms und des Paraganglioms. Paragangliome sind Stresshormon-produzierende Tumoren, die im Bauch-, Brust- und Kopf-Hals-Bereich auftreten können. Wenn sie in der Nebenniere entstehen, werden sie Phäochromozytome genannt. Diese Tumoren sind selten, meist gutartig und gut behandelbar. Die bösartigen Tumorvarianten sind dagegen sehr aggressiv. Die mittlere 5-Jahres-Überlebensrate der Patientinnen und Patienten liegt bei 45 Prozent. Eine wirksame Standardtherapie gab es bisher nicht. Doch die FIRST-MAPP-Studie (First International Randomised Study in MAlignant Progressive Phaeochromocytoma and Paraganglioma), die vom Institut Gustave Roussy in Paris und vom UKW organisiert worden war und die im vergangenen Jahr in The Lancet veröffentlicht wurde, lieferte erstmals den Nachweis, dass der Multityrosinkinasehemmer Sunitinib eine wichtige neue Therapieoption darstellt (Pressemeldung vom 23.02.2024). Diese aber auch andere bisher unpublizierte Daten, unter anderem zu Temozolomid, präsentierte Martin Fassnacht vor dem vollen Auditorium in Harrogate.