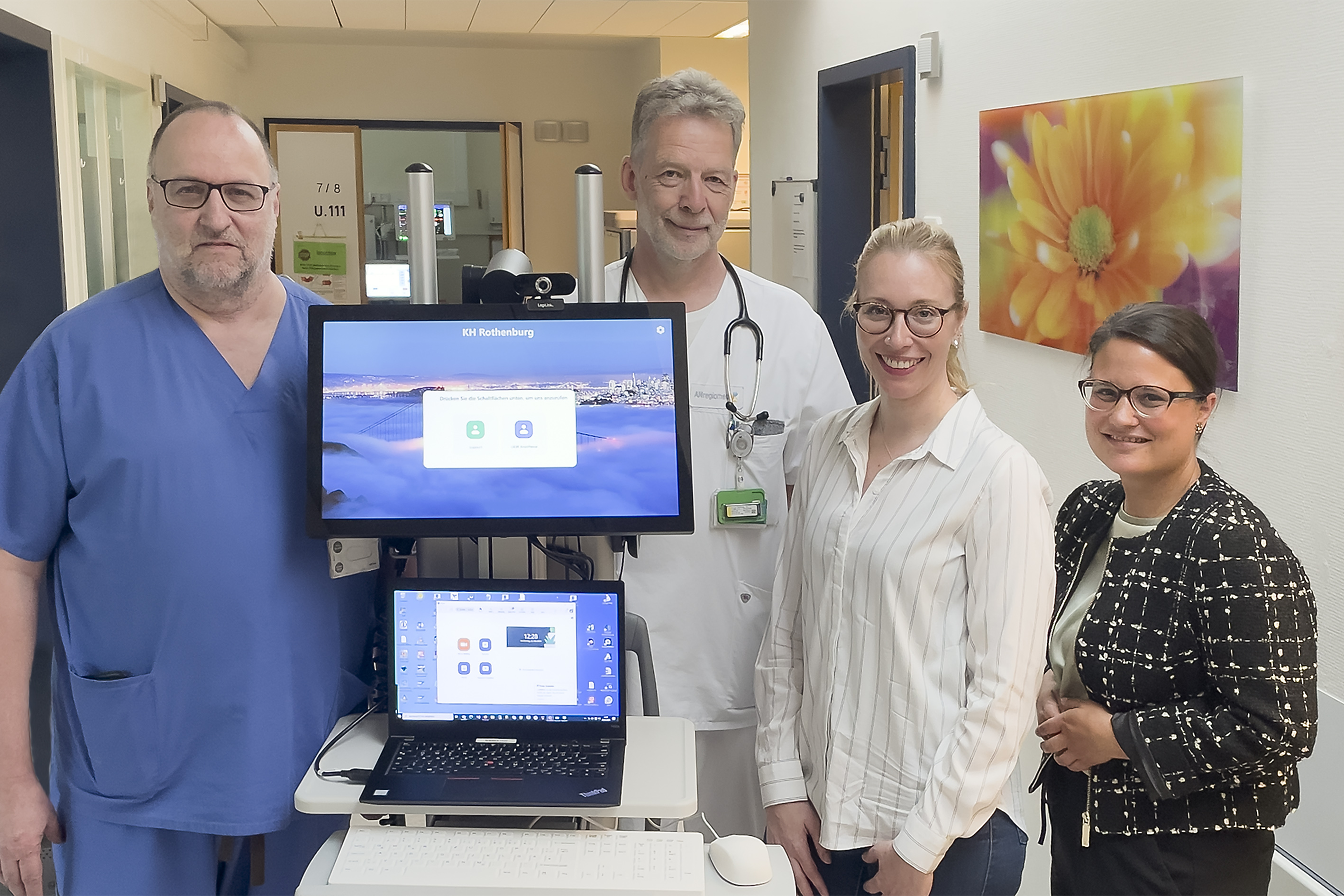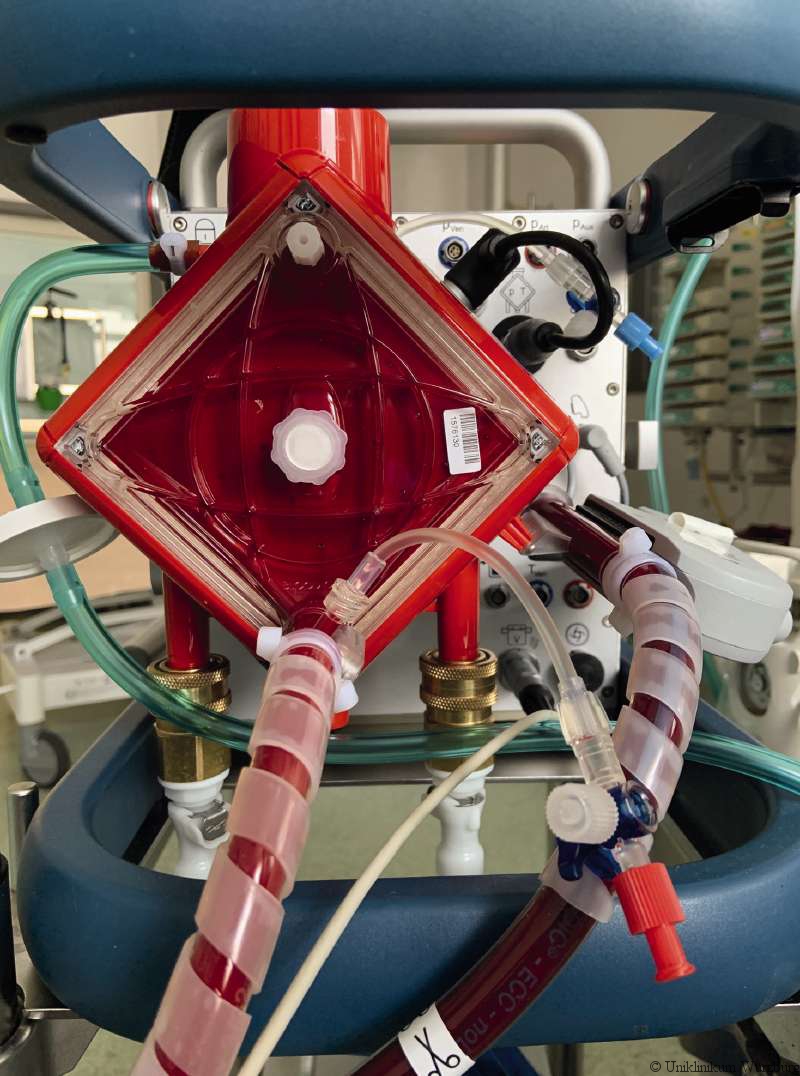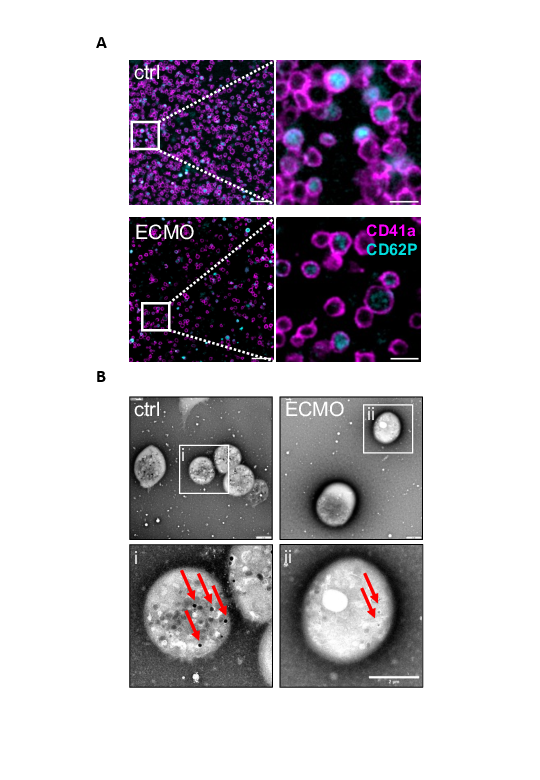Würzburg. Am Donnerstag, den 4. Juli 2024 veranstaltet die Medizinische Klinik II des Uniklinikums Würzburg (UKW) ihr 23. Myelom-Forum. Der langjährig etablierte Infotag richtet sich erneut an von der bösartigen Krebserkrankung des Knochenmarks Betroffene, deren Angehörige sowie alle sonstig Interessierte. Im Hörsaal 1 des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) an der Oberdürrbacher Straße greifen sechs laienverständliche Vorträge Themen aus Forschung, Diagnostik und Therapie auf.
Aussichtsreiche Therapiewaffen
„Mit in Deutschland jährlich 5000 bis 6000 Neuerkrankungen ist das Myelom nach der Leukämie die zweithäufigste Blutkrebserkrankung“, berichtet Prof. Dr. Hermann Einsele. Der Direktor der „Med II“ und Myelom-Experte fährt fort: „Glücklicherweise hat die Behandlung hier in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht.“ Zu den aussichtsreichen Therapiewaffen zählen nach seinen Angaben Immuntherapien mit Antikörpern oder Gen-manipulierten T-Zellen, den so genannten CAR-T-Zellen. Mit dem europaweit größten Myelom-Programm spielt das UKW bei der Erforschung, Anwendung und Ausweitung dieses neuen Arzneimittelprinzips eine international bedeutende Rolle. Einer der Forumsvorträge wird verdeutlichen, wie Patientinnen und Patienten von den vielen am UKW angebotenen klinischen Studien profitieren können.
Besseres Verständnis der Krankheit
„Auch das Wissen über die grundsätzlichen Eigenschaften der Erkrankung wächst kontinuierlich. Beim Forum werden die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Beispiel mehr über die individuellen Ausprägungen des Myeloms erfahren“, kündigt Prof. Einsele an. Die hier in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse sind nach seinen Worten für noch zielführendere Therapien höchst relevant.
Lebensqualität zurückgewinnen
Es steht außer Frage, dass die Symptome der schweren Erkrankung selbst, aber auch die Nebenwirkungen in deren Therapie die Psyche der Betroffenen stark belasten und die Lebensqualität einschränken können. Ein Experte der Psychoonkologie wird beim Forum ganz lebenspraktisch aufzeigen, was die Patientinnen und Patienten in dieser fordernden Situation selbst für ihr Wohlbefinden tun können.
Bitte rechtzeitig anmelden
Die Veranstaltung startet um 15:00 Uhr. Nach jedem Vortrag haben die Teilnehmenden Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Teilnahme am Forum ist kostenlos, eine Spende von 10 Euro an die Stiftung „Forschung hilft“ wird jedoch gerne entgegengenommen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bis 26. Juni 2024 wichtig bei Gabriele Nelkenstock, der Selbsthilfebeauftragten des UKW, unter E-Mail: selbsthilfe@ukw.de.
Das genaue Programm findet sich im Veranstaltungskalender unter www.ukw.de/medizinische-klinik-ii.
Über das Multiple Myelom
Das Multiple Myelom ist eine Untergruppe des Lymphknotenkrebses. Dabei entarten im Knochenmark bestimmte Immunzellen. Sie überfluten den Körper mit fehlerhaft produzierten Antikörpern, unterdrücken durch ihr aggressives Wachstum die Blutbildung und schädigen durch verstärkten Knochenabbau das Skelett.
Text: Pressestelle / UKW