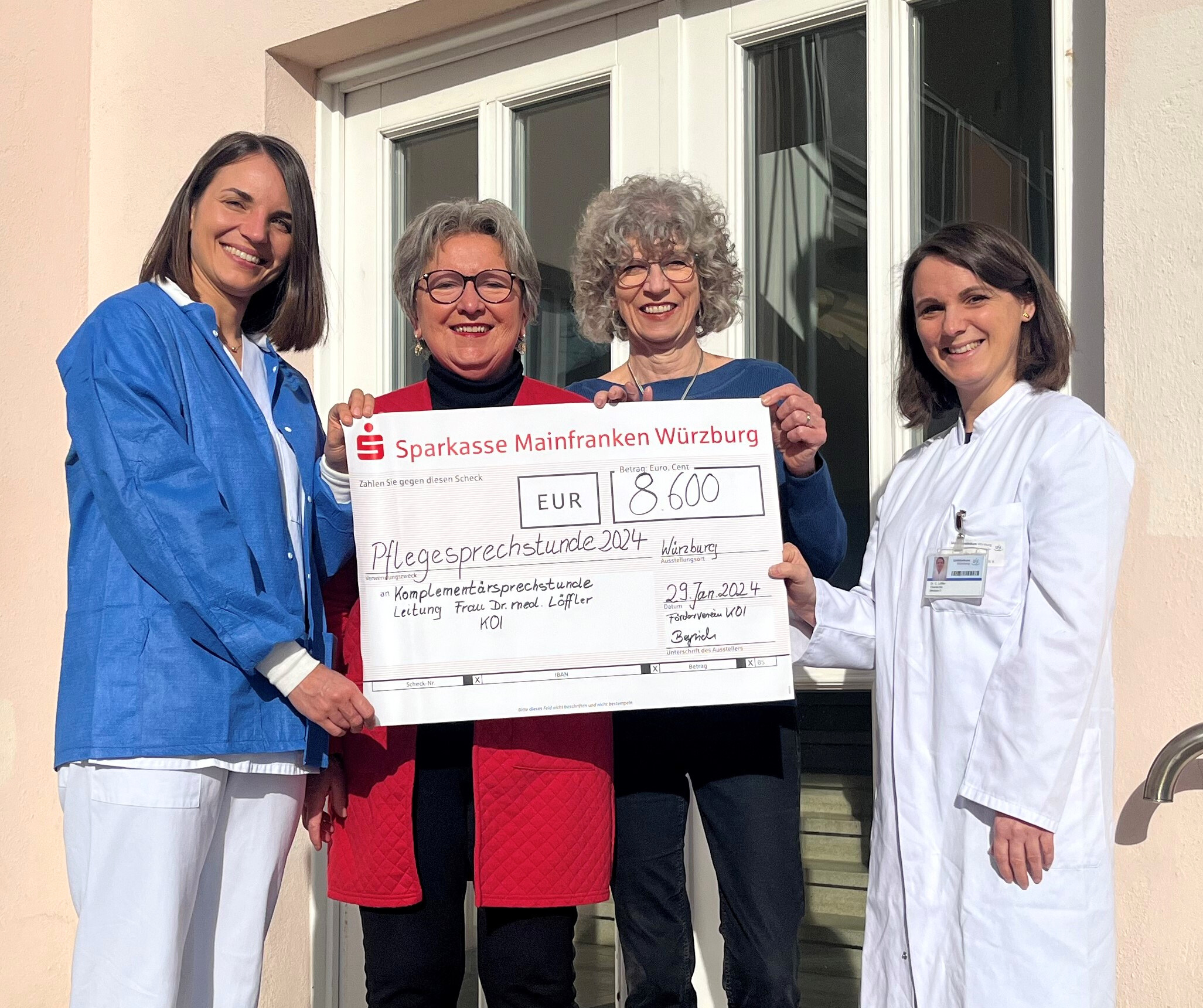Würzburg. Das Kinderwunschzentrum am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) hat neue, modern ausgestattete Räume im prägnanten Turm der UKW-Frauenklinik bezogen. Auf drei Etagen stehen nun Untersuchungs- und Behandlungsräume, mordernste Laboreinrichtung sowie die nötigen gesicherten Flächen für die Kryotanks zum Lagern von eingefrorenen Spermien oder Eizellen zur Verfügung. Jährlich werden am UKW-Kinderwunschzentrum etwa 750 Patientinnen und Patienten behandelt. Das Kinderwunschzentrum der Uniklinik zählt zu den größten Einrichtungen dieser Art in Unterfranken.
„Für unsere Patientinnen und Patienten mit Kinderwunsch stehen damit helle und moderne Räume am UKW zur Verfügung. Und das Team des Kinderwunschzentrums profitiert von den optimalen Rahmenbedingungen für diese wichtige Aufgabe“, betont PD Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der unterfränkischen Uniklinik. Zuvor waren die Räume des Kinderwunschzentrums im Untergeschoss der UKW-Frauenklinik an der Josef-Schneider-Straße untergebracht.
„Durch den Umzug auf die drei Etagen des Turms bleibt die enge Anbindung an die Frauenklinik und unsere verschiedenen Fachdisziplinen erhalten. Gleichzeitig konnte durch den Umbau und den Umzug jetzt ein passendes Ambiente geschaffen werden, das zur medizinischen Leistung auf universitärem Niveau passt“, freut sich Prof. Dr. Achim Wöckel, Direktor der Frauenklinik am UKW. Das Würzburger Universitätsklinikum investierte aus Eigenmitteln für den Umbau der Flächen im Gebäude aus den 1930er Jahren ca. 2,9 Millionen Euro. Die Flächen mussten zuvor entkernt und mit der nötigen technischen Infrastruktur ausgestattet werden. Die Bauarbeiten dauerten 18 Monate und wurden vom UKW (Geschäftsbereich Technik und Bau) geplant und ausgeführt.
Räumlich ist das Kinderwunschzentrum damit ein eigener Bereich für sich. In der ersten Etage befinden sich u.a. der Behandlungsraum und Büros, darüber direkt der Anmeldebereich mit zwei Untersuchungsräumen. In der dritten Etage befindet sich das Labor sowie ein extra ausgestatteter Raum für insgesamt 16 gesicherte Kryotanks und ein Raum zur Spermaabgabe. Für die entnommenen Eizellen gibt es einen eigenen kleinen „Proben-Aufzug“ zwischen den Etagen.
Schonende Kontrolle in speziellem Inkubator per Video
Direkt nach der Befruchtung der Eizelle im Kinderwunschzentrum werden diese in einem speziellen Inkubator gelagert, um dort den Erfolg einer Befruchtung zu kontrollieren. Als eine von nur wenigen Kliniken in Bayern setzt das UKW-Kinderwunschzentrum dafür einen speziellen „Time Lapse Inkubator“ ein. Dieser ermöglicht eine besonders schonende Überwachung der befruchteten Eizellen bzw. der sich dann entwickelnden Embryonen. Dr. Claudia Staib, Leiterin des Labors im Kinderwunschzentrum, erklärt: „Dadurch können wir eine Überwachung per Video vornehmen. Dies ist besonders schonend, denn so ist keine Entnahme aus dem Inkubator zur Kontrolle erforderlich. Das ist ein enormer Vorteil für den Erfolg einer künstlichen Befruchtung.“ Die Biologin betont zudem: „Der Begriff ´künstliche Befruchtung´ ist etwas irreführend: Natürlich findet die Befruchtung in einem Labor statt, aber der Vorgang ist zellbiologisch der gleiche wie im Körper. Nur die Umgebung ist eine andere.“ Ist eine Befruchtung erfolgreich, wird der Embryo nach fünf Tagen der Patientin eingesetzt.
Kinderwunsch erhalten bei Krebstherapie
Oberarzt Dr. Michael Schwab, Ärztlicher Leiter des UKW-Kinderwunschzentrums, erklärt: „Unerfüllter Kinderwunsch ist nicht ungewöhnlich. Bei etwa 15 Prozent der Paare im gebärfähigen Alter bleibt der Wunsch nach einem Kind unerfüllt. Daher werden bei uns zunächst beide Partner untersucht. Für die erfolgreiche Befruchtung stehen uns dann verschiedene Verfahren zur Verfügung.“ Eine wichtige Aufgabe des UKW-Kinderwunschzentrums sei es auch, Patientinnen und Patienten im Rahmen von „FertiPRotekt“ bei einer Krebserkrankung zu betreuen, die eine Chemo- oder Strahlentherapie vor sich haben. Dadurch kann bei erfolgreicher Behandlung ein späterer Kinderwunsch erfüllt werden. Dabei werden dann z.B. die Eizellen eingefroren, um sie bei einem späteren Zeitpunkt zu befruchten und einzusetzen.
Zur Hälfte liegen die Gründe beim Mann
Die Gründe für einen unerfüllten Kinderwunsch sind vielfältig, erklärt Reproduktionsmediziner Dr. Schwab. Allerdings gebe es eine merkliche Verschiebung: Lag früher der Grund zu etwa 30 Prozent beim Mann, sei dieser Anteil auf inzwischen rund 50 Prozent angestiegen. Schwab: „Auch bei Männern sinkt die Fruchtbarkeit bei steigendem Alter, das kann eventuell zu dieser Entwicklung beitragen. Wichtig ist daher eine exakte Diagnose.“ Dabei arbeiten die Würzburger Reproduktionsmediziner jeweils eng mit den übrigen Fachabteilungen des UKW zusammen, z.B. der Endokrinologie, wenn ein Verdacht auf Hormonstörungen besteht.
Das UKW-Kinderwunschzentrum ist als Mitglied des deutschen IVF-Registers auch mit dem entsprechenden Gütesiegel ausgezeichnet. Zudem können neue Entwicklungen aus der medizinischen Forschung der Universitätsmedizin schnell in die Behandlung integriert werden.
Eine anteilige Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung ist durch die Patientinnen und Patienten im Vorfeld abzustimmen.
Kontakt:
Universitäts-Frauenklinik Würzburg
Zentrum für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
Josef-Schneider Straße 4, 2. OG
97080 Würzburg
Tel.: 0931 20125619
E-Mail: kinderwunsch@ukw.de
www.ukw.de/kinderwunsch
Info: Fachbegriffe zur Kinderwunschbehandlung
In-Vitro-Fertilisation (IVF):
Dabei werden die durch Punktion gewonnenen Eizellen im Labor mit dem Sperma des Mannes zusammengegeben, so dass eine Befruchtung stattfindet. Hat sich die Eizelle nach 24 Stunden in mehrere Zellen geteilt, spricht man von einem Embryo, der dann in die Gebärmutter transferiert wird.
Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI):
Diese Variante der IVF wird bei verminderter Spermienkonzentration und -qualität angewandt. Dabei wird ein einzelnes Spermium wird unter dem Mikroskop direkt in die Eizelle eingebracht.