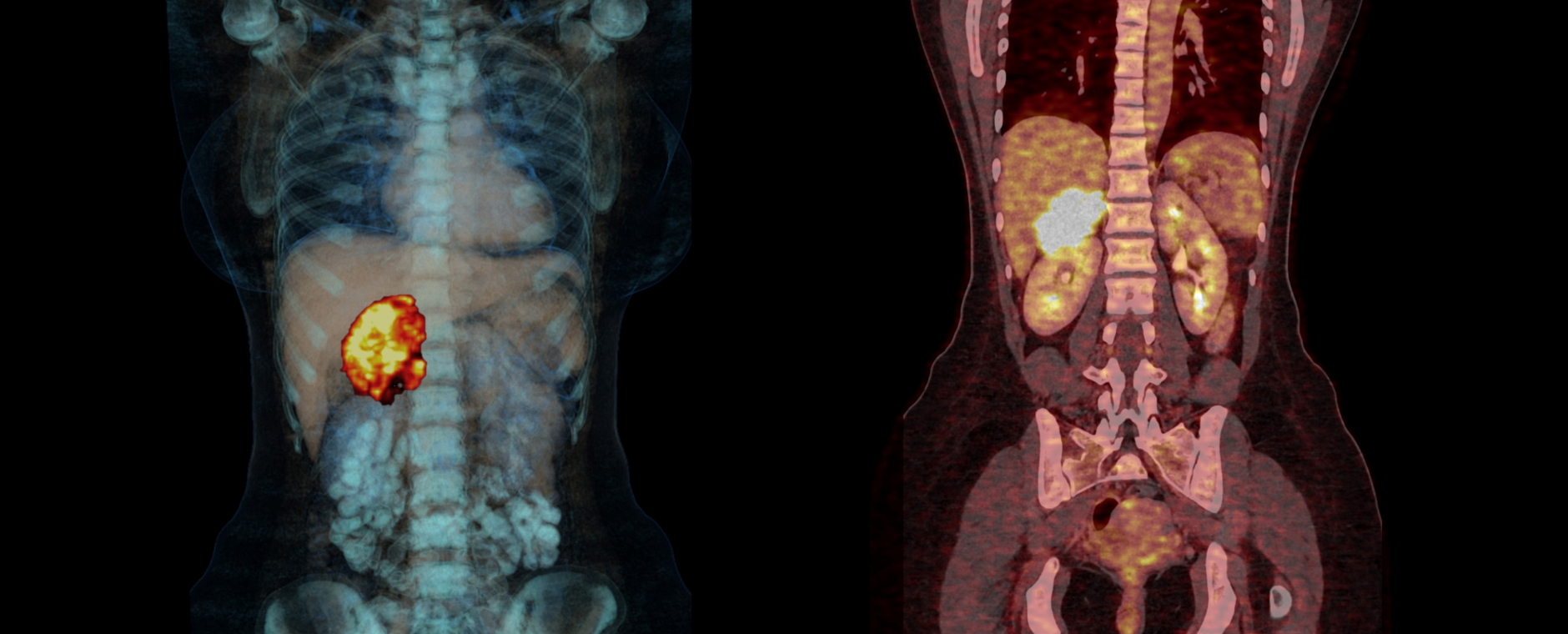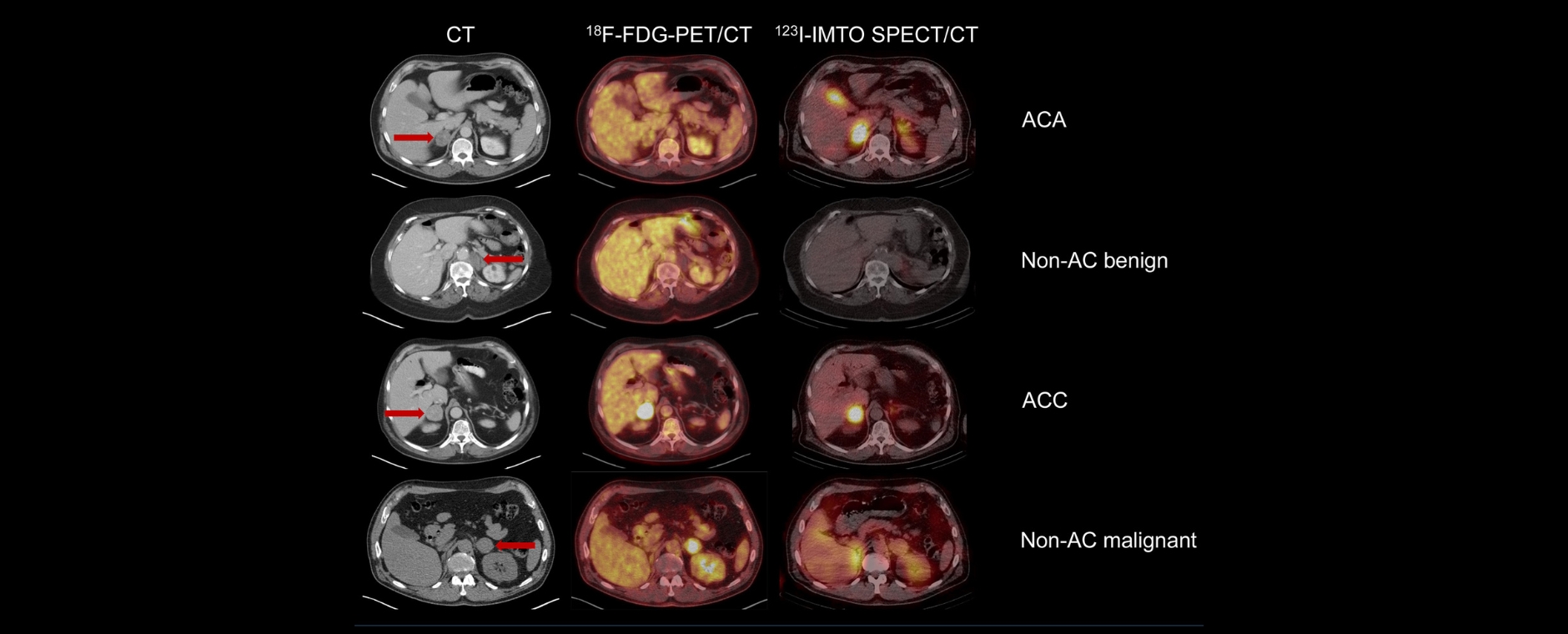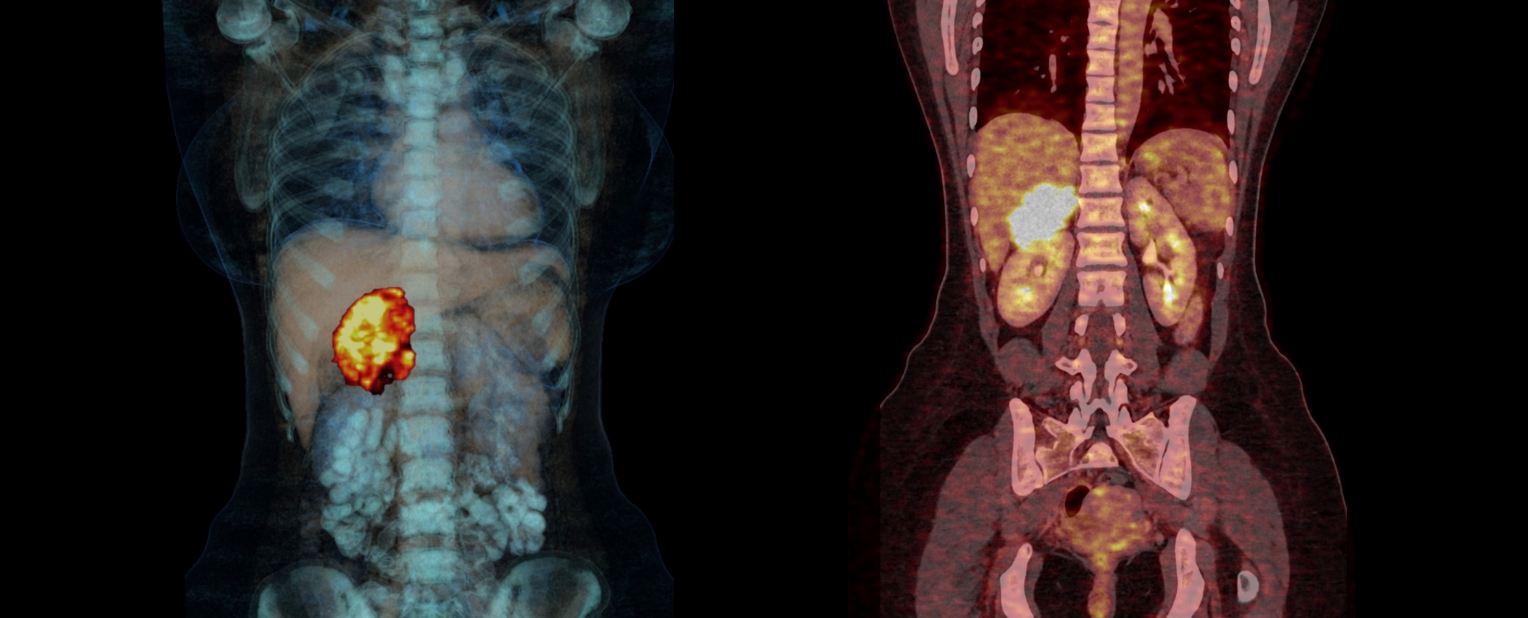Durch die Operation kommt es zu durchgreifenden Änderungen diverser endogener Stoffwechselhormone, sowie zu einem Rückgang der systemischen Entzündung, mit nachhaltigen Auswirkungen auf Adipositas-assoziierte Komorbiditäten. Eine genaue Kenntnis über die Vergleichbarkeit von hormonellen Veränderungen des Stoffwechsels zwischen Menschen und Versuchstieren (hier Ratten) ist eine Grundvoraussetzung für den sinnvollen Einsatz von Tierversuchen, die unterschiedliche Physiologie ist jedoch nicht ausreichend erforscht.
Ein Team der Würzburger Universitäts-Endokrinologie und Chirurgie untersuchte 20 stark übergewichtige Personen vor und ein Jahr nach einer RYGB-Operation sowie übergewichtige Ratten sieben Wochen nach einem entsprechenden Eingriff. In den Blutproben wurden verschiedene metabolische Hormone, Entzündungsmarker und Aminosäuren mit verschiedenen Messmethoden bestimmt.
Ein Jahr nach der Operation sanken beim Menschen vor allem die Nüchternspiegel von Insulin und Leptin, passend zur Besserung der Insulinsensitivität sowie der Abnahme der Körperfettmasse. Unerwartet fielen bei Menschen auch die appetithemmenden Hormone GLP-1 und PYY nach der Operation ab, während sie bei den Ratten anstiegen. Es ist davon auszugehen, dass die Effekte dieser Hormone eher postprandial, also nach dem Essen, von Bedeutung sind, darüber hinaus werden im Laufe der Zeit regulatorische Mechanismen neu justiert. Entzündungsmarker wie IL-6 und MCP-1 gingen beim Menschen deutlich zurück, was auf die entzündungshemmende Wirkung des Eingriffs hinweist. Dies ist vor allem für die Gesundheit, beispielsweise für das Herz-Kreislauf- und Stoffwechselsystem, relevant. Bei Ratten war dieser Effekt allerdings nicht festzustellen.
Die Forscher beschäftigten sich auch mit der Frage, ob anhand von Nüchternspiegeln diverser Stoffwechselhormone Patientinnen und Patienten identifiziert werden können, die besonders von einer solchen Operation profitieren würden. Patientinnen und Patienten mit höheren GLP-1-Werten vor der OP verloren tendenziell mehr Gewicht. Daher könnte das Hormon als prognostischer Marker dabei helfen, im Voraus einzuschätzen, wer besonders gut auf die Operation anspricht. Die essentielle Aminosäure Leucin zeigte eine positive Korrelation mit dem GLP-1-Wert nach zwölf Monaten bei Menschen, jedoch nicht bei Ratten. Eine gesonderte Ergänzung der Nahrung mit dieser Aminosäure könnte daher sinnvoll sein.
Insgesamt zeigt die Studie, dass der Magenbypass nicht nur zu einer Gewichtsreduktion führt, sondern auch tiefgreifende hormonelle und entzündungsbezogene Veränderungen auslöst. Diese verlaufen beim Menschen teils anders als im Tiermodell. Die Unterschiede zwischen Mensch und Tiermodell, insbesondere hinsichtlich der Entzündungsreaktion, zeigen einmal mehr, dass Tierdaten nur mit Vorsicht auf Menschen übertragen werden können.
Simon Kloock, Lukas Scheller, Julia Hasinger, Ilja Balonov, Max Kurlbaum, Martin Fassnacht, Ann-Cathrin Koschker, Florian Seyfried, Ulrich Dischinger. In-depth analysis of metabolic hormones and inflammatory markers following Roux-en-Y gastric bypass in humans and rodents: similarities and differences. Diabetes Research and Clinical Practice. Volume 229, 2025, 112923, ISSN 0168-8227, https://doi.org/10.1016/j.diabres.2025.112923.