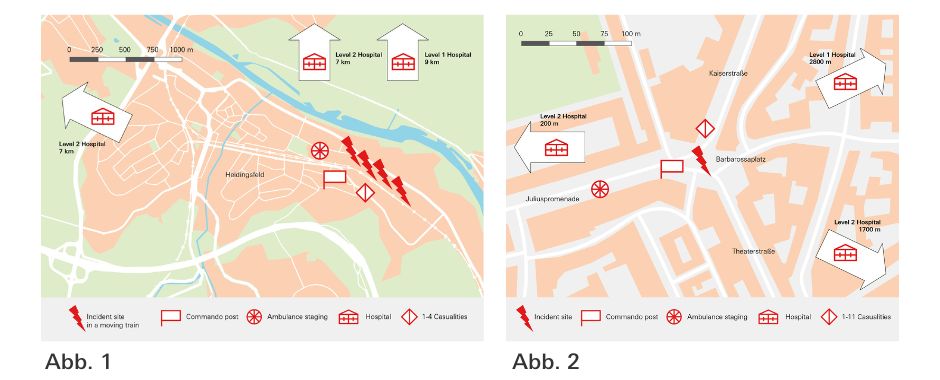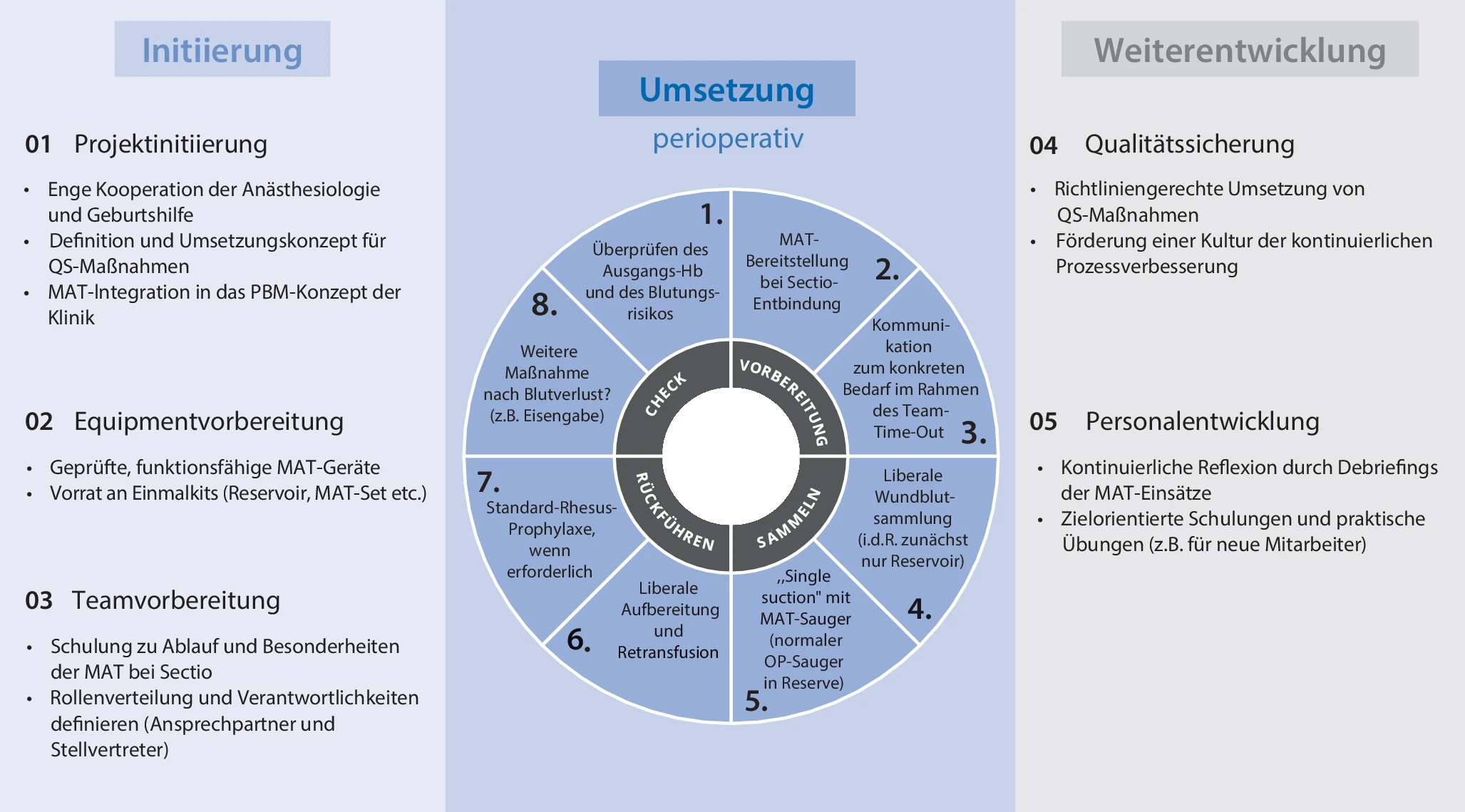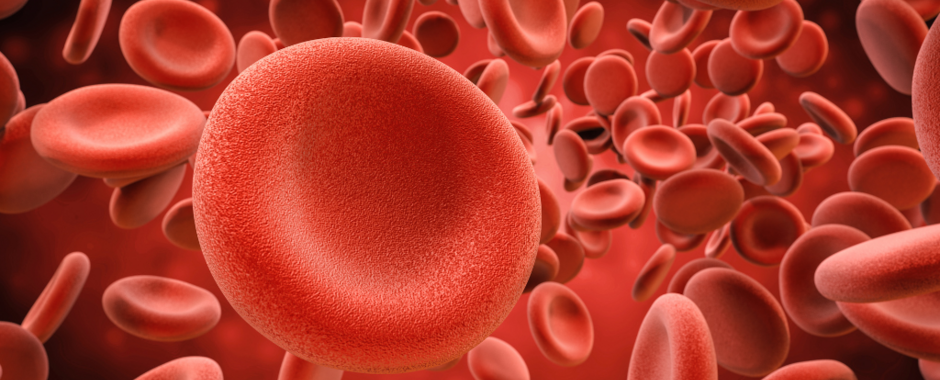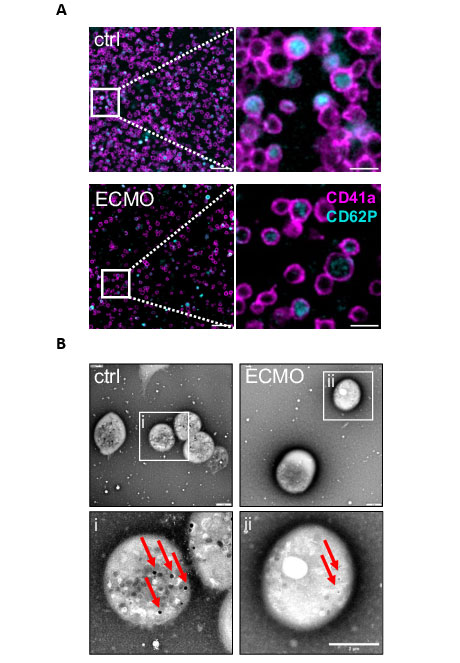Unsere Ergebnisse zeigen, dass KI-generierte Analysen in Bezug auf sprachliche Qualität, logische Ableitbarkeit und Fachkompetenz mit den Expertenanalysen vergleichbar sind. Die KI konnte zudem Meldungen eigenständig in thematisch relevante Kategorien einordnen, was eine systematische Analyse und Strukturierung der Vorfälle ermöglicht. Dieses automatisierte Feedback könnte die Akzeptanz und Nutzung von CIRS erheblich fördern, indem es Gesundheitsfachkräften zeitnah wertvolle Informationen liefert.
Diese Studie verdeutlicht das transformative Potenzial von KI-gestützten Ansätzen im Bereich der Patientensicherheit. Sie bietet einen Ansatz für die Weiterentwicklung von CIRS und eröffnet neue Perspektiven für den Einsatz von KI in der Gesundheitsversorgung.
Carlos Hölzing, Sebastian Rumpf, Stephan Huber, Nathalie Papenfuß, Patrick Meybohm, Oliver Happel. The Potential of Using Generative AI/NLP to Identify and Analyse Critical Incidents in a Critical Incident Reporting System (CIRS): A Feasibility Case-Control Study. Healthcare (Basel). 2024 Oct 2;12(19):1964. doi: 10.3390/healthcare12191964. PMID: 39408144; PMCID: PMC11475821.