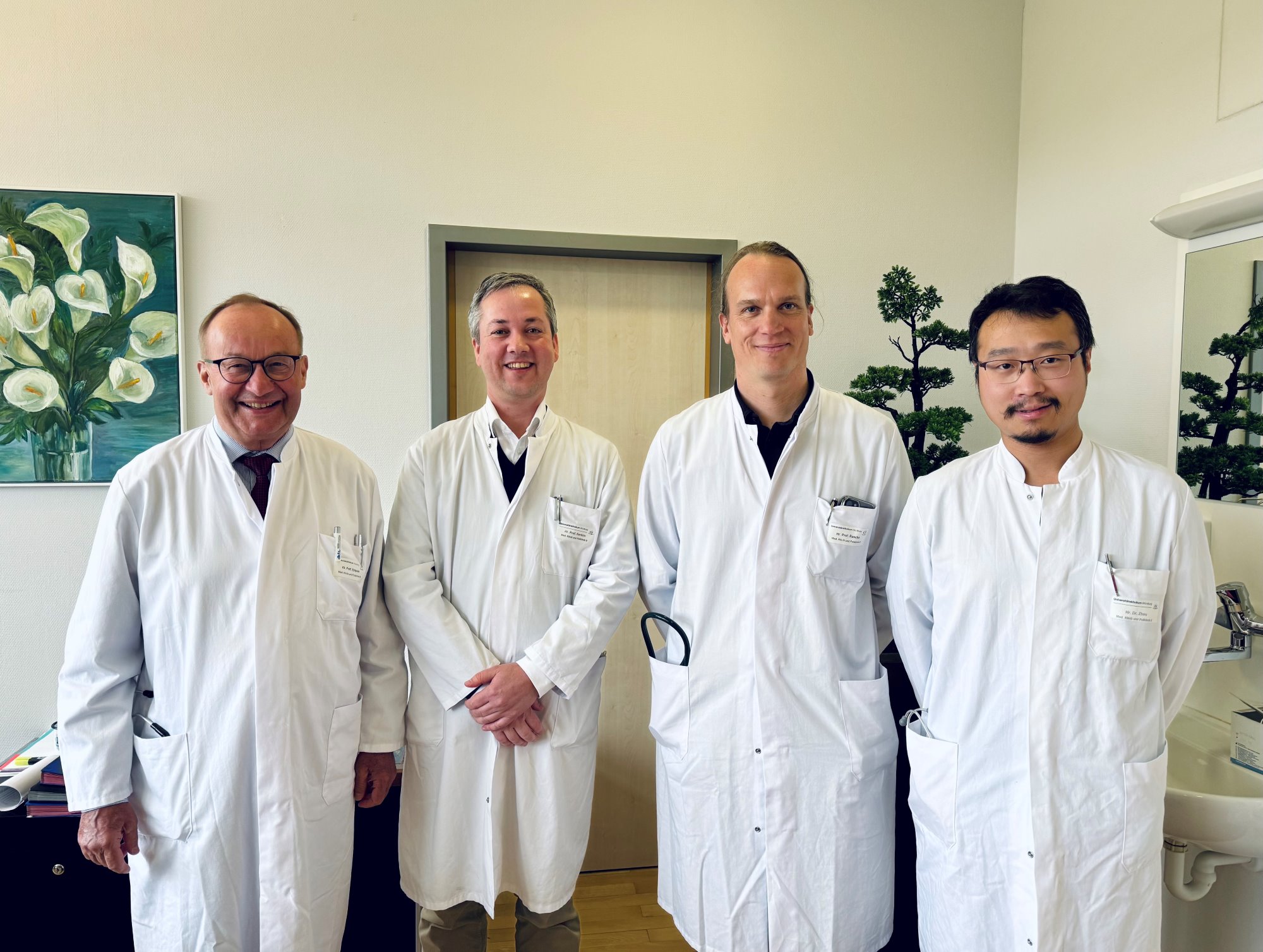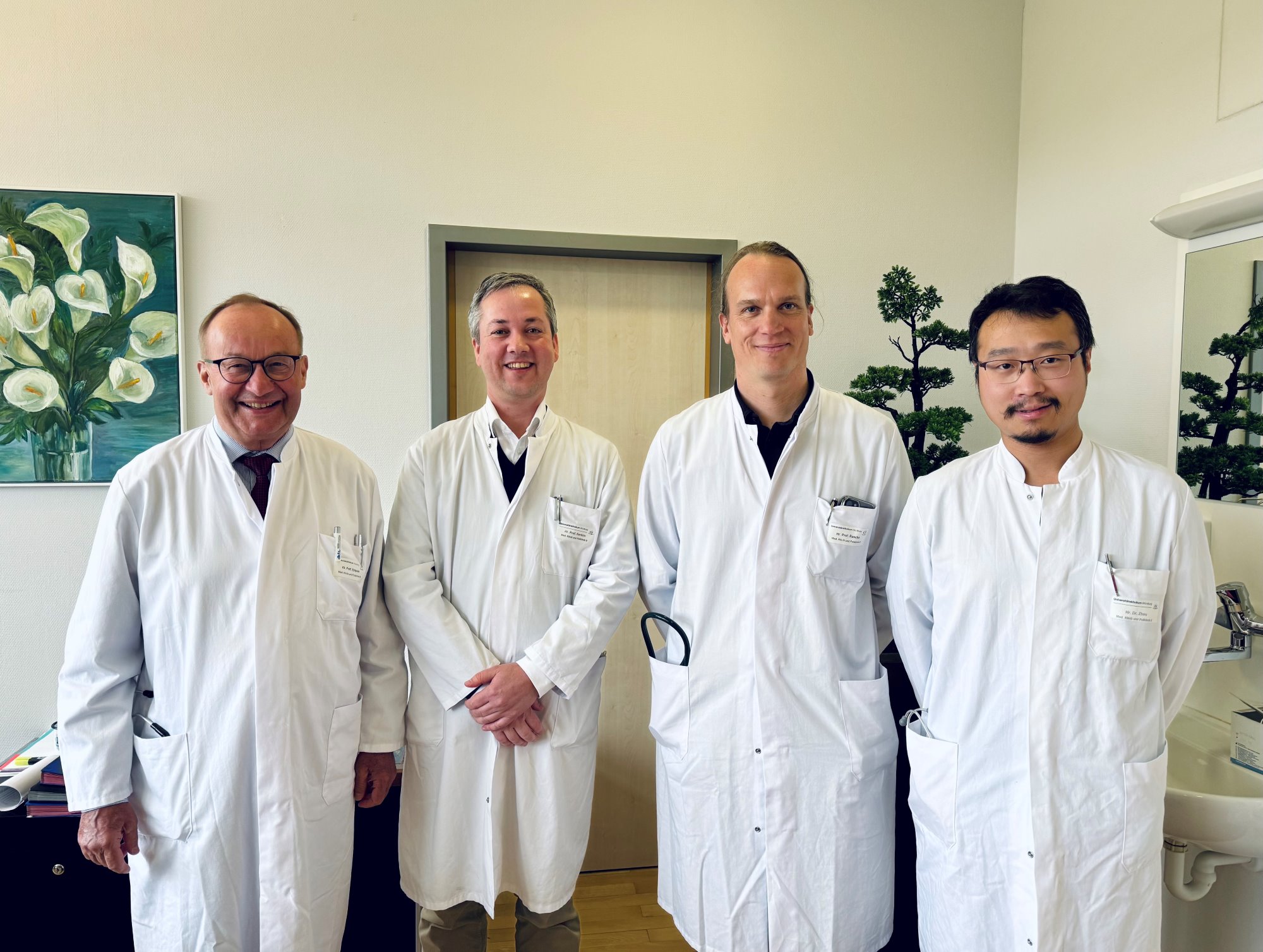
Würzburg. Das Multiple Myelom ist nach der Leukämie die zweithäufigste Blutkrebserkrankung, bei der verschiedene bösartige Tumorherde im Knochenmark entstehen. In Deutschland erkranken jährlich etwa 7.000 Menschen an dieser Krebsform, die bislang nicht dauerhaft geheilt werden kann. Durch neue Therapiemöglichkeiten hat sich die Prognose für viele Patientinnen und Patienten verbessert. Bei einem Hochrisiko-MM (HR-MM) schreitet die Erkrankung jedoch schneller voran und die Überlebenschancen sind trotz moderner Behandlungsmethoden deutlich schlechter. Umso wichtiger ist eine frühe und genaue Risikoeinschätzung. Denn klinische Studien konnten zeigen, dass eine risikoadaptierte Therapie die Prognose verbessern kann.
Klinische und genetische Hochrisikomerkmale beim Multiplen Myelom
Es gibt klinische Hochrisikomerkmale wie die extramedulläre Erkrankung oder die Plasmazellleukämie, wenn sich die Myelomzellen außerhalb des Knochenmarks ausbreiten oder im Blut zirkulieren. Darüber hinaus gibt es genetische Faktoren, die auf ein hohes Risiko hinweisen. Um Veränderungen im Erbgut der Krebszelle zu erkennen, darunter die Chromosomenveränderungen del(17p), t(4;14) und +1q21, wird die zytogenetische Analyse mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) eingesetzt. Zusätzlich kann eine Genexpressionsanalyse tiefere biologische Einblicke in die Erkrankung geben. Der SKY92-Biomarker besteht aus 92 Genen, deren Aktivität in bösartigen Myelom-Plasmazellen die Aggressivität des Myeloms bestimmen.
FISH und SKY92: Zwei Methoden zur Risikoeinschätzung kombiniert
Die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Martin Kortüm, Inhaber des Lehrstuhls für Translationale Myelomforschung am Uniklinikum Würzburg (UKW), kombinierte in ihrer in der Fachzeitschrift HemaSpere publizierten Studie die diagnostischen Methoden FISH und SKY92 und analysierte, wie effektiv diese Kombination im klinischen Alltag ist, um Patientinnen und Patienten mit hohem Risiko zu identifizieren. Dazu untersuchten sie das Knochenmark von 258 Patientinnen und Patienten mit Multiplem Myelom, davon 109 mit neu diagnostiziertem Multiplem Myelom (NDMM) und 149 mit rezidiviertem/refraktärem Multiplem Myelom (RRMM).
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Kombination von FISH und SKY92 eine genauere Risikoeinschätzung ermöglicht. SKY92 hilft bei der Identifizierung von Hochrisikoerkrankungen, die mit FISH nicht erkannt werden, sowie bei der Identifizierung von Patienten mit Ultra-Hochrisiko-Merkmalen“, sagt Dr. Xiang Zhou, Assistenzarzt an der Medizinischen Klinik II des UKW unter der Leitung von Prof. Dr. Hermann Einsele und Erstautor der Studie.
„Unsere Erkenntnisse könnten in Zukunft dazu beitragen, die Behandlung besser auf das individuelle Risiko abzustimmen“, ergänzt Martin Kortüm. „Wenn wir ein erhöhtes Risiko frühzeitig kennen, könnten wir zum Beispiel aggressivere Therapien früher einsetzen oder neue Behandlungsansätze in Studien testen.“
Das Myelomzentrum am UKW ist eines der europaweit führenden Zentren für die Behandlung des Multiplen Myeloms und derzeit der einzige Anbieter des innovativen SKY92-Tests in Deutschland. „Die Anwendung ist allerdings noch experimentell“, erklärt Martin Kortüm. „Wir planen aber weitere Schritte, um unseren Patientinnen und Patienten diesen Test auch in der Regelversorgung anbieten zu können.“
Text: KL / Wissenschaftskommunikation
Publikation:
Xiang Zhou, Annika Hofmann, Benedict Engel, Cornelia Vogt, Silvia Nerreter, Yoko Tamamushi, Friederike Schmitt, Maria Leberzammer, Emilia Stanojkovska, Marietta Truger, Xianghui Xiao, Christine Riedhammer, Maximilian J Steinhardt, Mara John, Julia Mersi, Seungbin Han, Umair Munawar, Johannes M Waldschmidt, Claudia Haferlach, Hermann Einsele, Leo Rasche, K Martin Kortüm. Combining SKY92 gene expression profiling and FISH (according to R2-ISS) defines ultra-high-risk Multiple Myeloma. Hemasphere. 2025 Jan 23;9(1):e70078. doi: 10.1002/hem3.70078. PMID: 39850647; PMCID: PMC11754766.