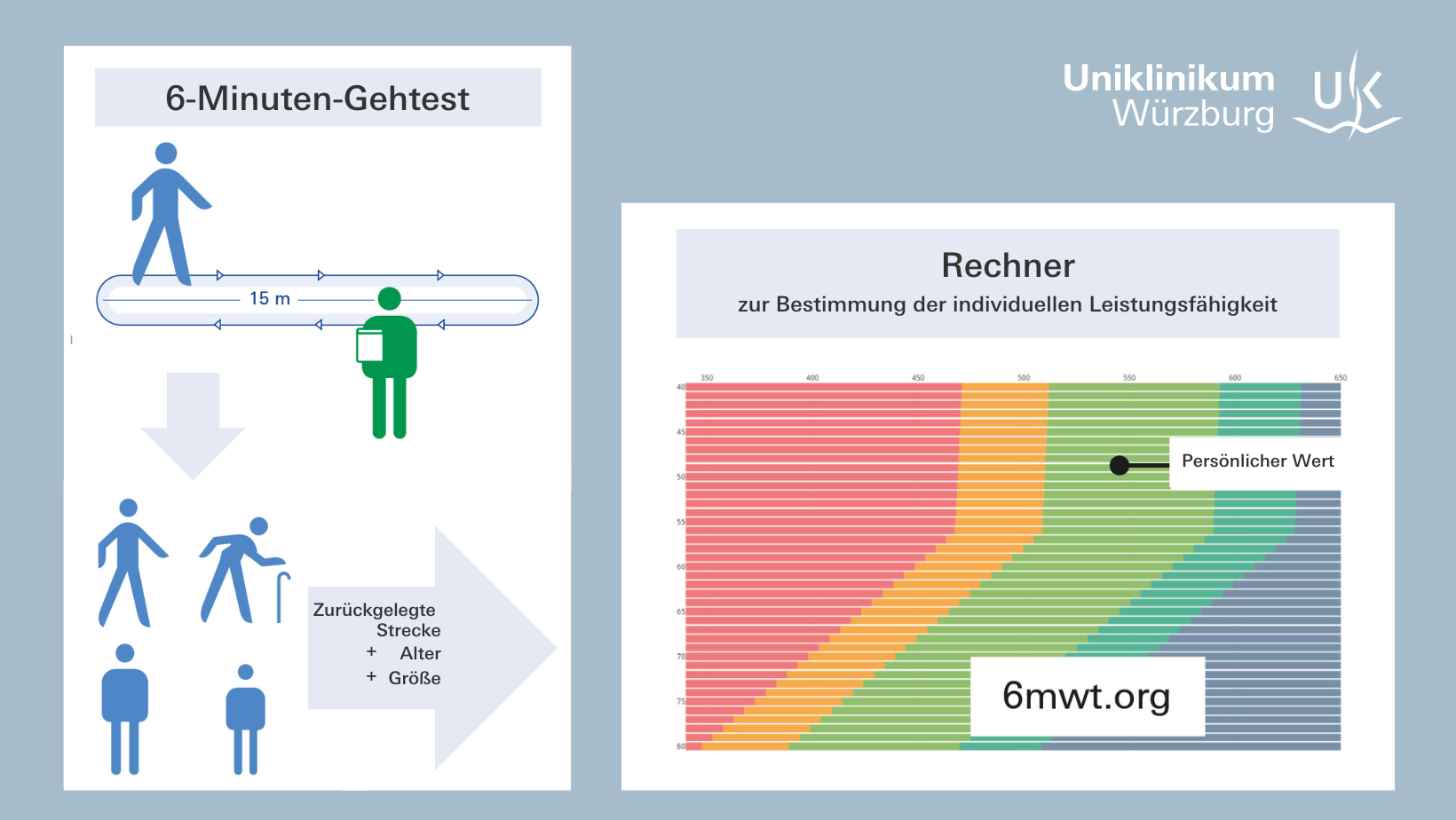Würzburg, im Februar 2024. Weil die Welt immer noch in großen Teilen von Männern für Männer gestaltet werde und erkannt werden müsse, dass eine größere Vielfalt zu mehr Innovation führt, hat die UNESCO den 11. Februar zum Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft erkoren.
Auch das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) setzt sich für Diversität in der Wissenschaft und Chancengleichheit ein. Es gibt auf dem Campus zahlreiche Fördermaßnahmen und Mentoring-Programme - und es gibt die Serie #WomenInScience mit inzwischen mehr als 20 weiblichen Rollenvorbildern. In den Porträts berichten Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen und Technologinnen von der Faszination ihrer Forschung, ihren Entdeckungen, die das Leben vieler Patientinnen und Patienten bereits verbessert haben und zum Verständnis zahlreicher Erkrankungen beigetragen haben sowie von Meilensteinen und Hindernissen. Die Forscherinnen machen auch auf gesellschaftliche Rahmenbedingungen und konservative Rollenbilder aufmerksam, die eine Karriere in der Wissenschaft erschweren.
Zukunftsgewandte Strukturen durch flachere Hierarchien
„Die gläserne Decke ist noch da und es ist schwer, sie als Frau zu durchbrechen“, sagt Professorin Heike Rittner, die seit November 2023 den Lehrstuhl für Schmerzmedizin hat und somit zu den 27 Prozent der Professorinnen an der Medizinischen Fakultät gehört (siehe Infokasten Geschlechterverhältnis). Die Mutter von drei Kindern gibt zu bedenken: „Die mächtigsten Positionen sind überwiegend von Männern besetzt.“ Ihrer Meinung nach müssten die Strukturen in der Universitätsmedizin zukunftsgewandter werden: flachere Hierarchien, die mehr Eigenverantwortlichkeit und Juniorgruppen ermöglichen, könnten mehr Frauen, aber auch mehr Männer für die Forschung begeistern. In Yale habe sie „genial gute“ Erfahrungen mit departmentartigen Strukturen gemacht.
Mehr Frauen in Entscheidungsgremien
Auch Professorin Malgorzata Burek, Biologin und Frauenbeauftragte an der Medizinischen Fakultät legt den Finger in die Wunde: „Die meisten Regeln werden von Männern gemacht. Aber viele Männer wissen gar nicht, was gebraucht wird, welche Entscheidungen wichtig sind. Erst wenn mehr Frauen in den Entscheidungsgremien sitzen, kann sich etwas ändern - zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen und mehr Planbarkeit.“ Dazu zählen Vertragsverlängerungen, unbefristete Stellen und flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie mehr Kooperation statt Konkurrenz. Zu den größten Hindernissen zählt Malgorzata Burek zufolge das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das eine hohe Fluktuation vorsieht, um Innovationen zu fördern. Doch wer so viele Anstrengungen auf sich nimmt, müsse Ziele haben und langfristige Sicherheiten.
Der Leidenschaft folgen und Bedingungen schaffen, diese ausleben zu können
Generell könne der Arbeitsalltag als Clinician Scientist, also als Behandelnde, die gleichzeitig forschen, sicher noch etwas familienfreundlicher werden, meint Professorin Stefanie Hahner. Die stellvertretende Leiterin der Endokrinologie am UKW und Mutter von zwei Kindern zweifelt manchmal daran, ob sie angesichts ihres Arbeitspensums ein gutes Vorbild sei. „Am Ende liegt aber vieles auch an uns selbst. Entscheidend ist, dass wir Freude an unserer Tätigkeit haben und dass diese Freude ausstrahlt. Dann wird diese sehr vielseitige und bereichernde Tätigkeit nicht nur für uns, sondern auch für andere attraktiv.“ Die Leidenschaft eint alle porträtierten Forscherinnen: immer wieder neue Fragestellungen zu finden und Antworten zu suchen, die eines Tages zu besseren Behandlungsmöglichkeiten führen könnten.
Vom inneren und äußeren Druck, zuhause bei den Kindern zu bleiben
„Wenn Sie Ihre Leidenschaft gefunden haben, umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen dabei helfen, sie auszuleben. Es ist wichtig, nicht nur ein unterstützendes berufliches Umfeld zu haben, sondern auch ein privates“, berichtet die Neurobiologin und Juniorprofessorin Rhonda McFleder. Als zweifache Mutter kennt sie den Druck von innen und außen, sich als Frau mehr um die Kinder kümmern zu müssen. „Ich habe glücklicherweise ein großartiges Unterstützungssystem, das mir hilft, diesen Druck zu bekämpfen und meine Träume zu verfolgen. Um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, müssen wir diesen Druck, zu Hause zu bleiben, beseitigen und Frauen zu gleichberechtigten Mitgliedern sowohl am Arbeitsplatz als auch im Haushalt machen.“
Vom perfekten Zeitpunkt Kinder zu bekommen
Den einen perfekten Zeitpunkt für eine Familiengründung gebe es laut Stefanie Hahner nicht. Dazu seien die individuellen Bedingungen zu unterschiedlich. „Familie zu haben ist immer eine Herausforderung, jedoch kein Hindernis für eine akademische Karriere. Die Bedingungen für Frauen heute sind ausbaufähig, aber sehr viel besser als sie es noch vor ein paar Jahren waren, da inzwischen viele Förderprogramme mit flexibler Berücksichtigung von Elternzeiten existieren. Mitunter habe ich mit Frauen aber auch schon über die Möglichkeit von Social Freezing gesprochen, um den zeitlichen Druck der Familiengründung herauszunehmen. Schöner wäre natürlich die Möglichkeit, alles parallel gut integrieren zu können und daran gilt es gemeinsam weiter zu arbeiten.“
„Als etablierte Wissenschaftlerin Mutter zu werden ist deutlich einfacher und entspannter, weil vieles schon geregelt ist. Man hat eine eigene Arbeitsgruppe, vertraute Mitarbeitende, die wissen, was im Labor zu tun ist“, bemerkt Malgorzata Burek, die ihr drittes Kind bekam, als sie sich habilitierte.
Hilfe annehmen – zuhause und bei der Arbeit
„Und man sollte Hilfe annehmen!“, rät Heike Rittner, die immer wieder feststellt, dass die Hemmschwelle bei den heutigen Müttern, einen Babysitter oder eine Kinderbetreuung zu engagieren, extrem hoch ist. Es sei etwas dran an dem Sprichwort „Es braucht ein Dorf, um Kinder zu erziehen“. „Unsere Kinderfrauen habe auch immer wieder neue Aspekte in die Erziehung eingebracht. Und im Notfall war ich schnell zur Stelle. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt: in der Nähe der Klinik zu wohnen! Wenn man kurze Wege hat, spart man viel Zeit.“
Nicht nur als Mutter, auch als Klinikerin sollte man sich von dem Gedanken befreien, alles selbst machen zu wollen und zu können, empfiehlt Professorin Claudia Sommer, die mit Heike Rittner die Forschungsgruppe KFO 5001 Resolve PAIN leitet. „Hier in der Universitätsmedizin Würzburg gibt es zum Beispiel hervorragende Grundlagenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die viele Techniken wesentlich besser beherrschen und mir in kniffligen Fragen zur Seite stehen.“
Aufbrechen der klassischen Rollen - Mann und Frau als Team verstehen
Generell seien Teams und das persönliche Miteinander im Team unabdingbar. „Es bringt nichts, wenn man zehn Genies zusammensetzt, die nicht miteinander kommunizieren. Ellenbogen raus, das funktioniert nicht“, ist die Medizinstudentin Isabell Wagenhäuser der Meinung. Auch Mann und Frau sollten sich mehr als Team verstehen und als Team wahrgenommen werden. Bezüglich Eltern- und Erziehungszeit sollten Frauen und Männer gleichbehandelt werden, nicht nur auf dem Papier, auch in der Kommunikation, in der übertragenen Arbeit und Verantwortung. „Männer sollten sich trauen, für die Familie beruflich kürzer zu treten und tatsächlich eine Zeit lang Teilzeit zu arbeiten. Das darf weder für Männer noch für Frauen ein Karriereknick bedeuten“, wünscht sich die angehende Neurochirurgin Dr. Vera Nickl. „Je mehr Männer und Frauen zeigen, dass es gleichverteilt geht, desto besser!“ meint die Physikerin, Psychologin und Mutter Dr. Anne Saulin. Der Kulturwandel hat begonnen, jetzt muss er noch weiterentwickelt und gefestigt werden.
„Es geht nicht um das Geschlecht, sondern um Wissen, Ideen und Leistung.“
„Wir müssen mit Stereotypen brechen“, bringt es Marah Alsalkini auf den Punkt. Die Medizinerin kam vor zwei Jahren von Syrien nach Deutschland und stellt derzeit am UKW aus dem Gewebe von Hirntumoren 3D-Organoide her, um seine Eigenschaften zu erforschen und neue Therapieansätze zu testen. „Frauen sollten mehr Selbstvertrauen haben und sich nicht von Hindernissen oder Schwierigkeiten aufhalten lassen. Alles ist erreichbar. Es geht nicht um das Geschlecht, sondern um Wissen, Ideen und Leistung. Ich wünsche mir nicht nur Gleichberechtigung, unabhängig von Geschlecht, sondern auch von Nation und Religion.“
Chancengleichheit, Offenheit und gute Kommunikation – auf allen Ebenen
Chancengleichheit versteht auch Isabell Wagenhäuser unter dem Aspekt „als der Mensch gesehen zu werden, der man ist, mit all seinen Kompetenzen, nicht nur fachliche, sondern auch die soft skills, und das unabhängig von geschlechtsspezifischen Rollenbildern.“ Ebenfalls ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen Offenheit und eine gute Kommunikation. Dass wir einander offen und ohne Vorurteile begegnen und miteinander kommunizieren.
Gemeinsam mit Julia Reusch arbeitet Isabell Wagenhäuser an der CoVacSer-Studie, einer Kooperation der Zentralen Einrichtung für Krankenhaushygiene und Antimicrobial Stewardship und der Medizinischen Klinik I des UKW. Auf Konferenzen beobachten die beiden Studentinnen regelmäßig das Auftreten von Männern und Frauen und vergleichen dieses. Ihr Fazit: „Es ist wichtig, selbstbewusst aufzutreten und die eigene Kompetenz zu präsentieren, ohne dabei arrogant zu wirken. So funktioniert dann auch wissenschaftlicher Austausch und Zusammenarbeit auf Augenhöhe - unabhängig von Rollenbildern und dem Geschlecht.“
Empowerment und Wertschätzung
Professorin Bettina Baeßler erinnert daran, auch die leisen Potentiale zu fördern, also die Menschen, die eher introvertiert sind. Dazu zählen häufig Frauen. Diese gilt es zu sehen, zu heben und zu entdecken. Stefanie Hahner, die Mitglied in der Gleichstellungskommission ist und sich als Prodekanin der Medizinischen Fakultät um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses kümmert, fügt hinzu: „Als Mentorin setze ich auf Empowerment, was eine gewisse Selbstwirksamkeit mit sich bringt und zum Erfolg führt.“
Alle sind sich einig: Es braucht Rollenmodelle! Frauen in Führungspositionen, als Oberärztinnen, Chefärztinnen und Direktorinnen, die fördern und fordern. Unterm Strich sollten Frauen die gleiche Wertschätzung für ihre Arbeit erfahren wie Männer – das gilt in der Klinik, in der Forschung und in der Gesellschaft.
Geschlechterverhältnis in der Medizinischen Fakultät
Bei Medizinstudium und Promotion lag in Würzburg in den vergangenen Jahren der Anteil der Frauen stetig über dem der Männer. So nahmen im Jahr 2022 insgesamt 497 Frauen ihr Medizin- und Zahnmedizinstudium in Würzburg auf (67%), 350 absolvierten es (61%) und 132 Frauen (63%) promovierten. Bei der Habilitation wechselt das Geschlechterverhältnis: Im Jahr 2022 haben sich sechs Frauen habilitiert (20%). Bei den W1-Professuren war das Geschlechterverhältnis mit 6:6 im Jahr 2022 ausgeglichen, von den W2/C3-Professuren waren 26 (30%) von Frauen besetzt und 61 von Männern, bei den W3-Professuren sank der Anteil der Frauen auf 19%. Mit einem Professorinnen-Anteil von insgesamt 27 Prozent liegt die Medizinische Fakultät Würzburg über dem Durchschnitt in Bayern (24%) und in Deutschland (23%).
Die ausführlichen Porträts finden Sie hier.