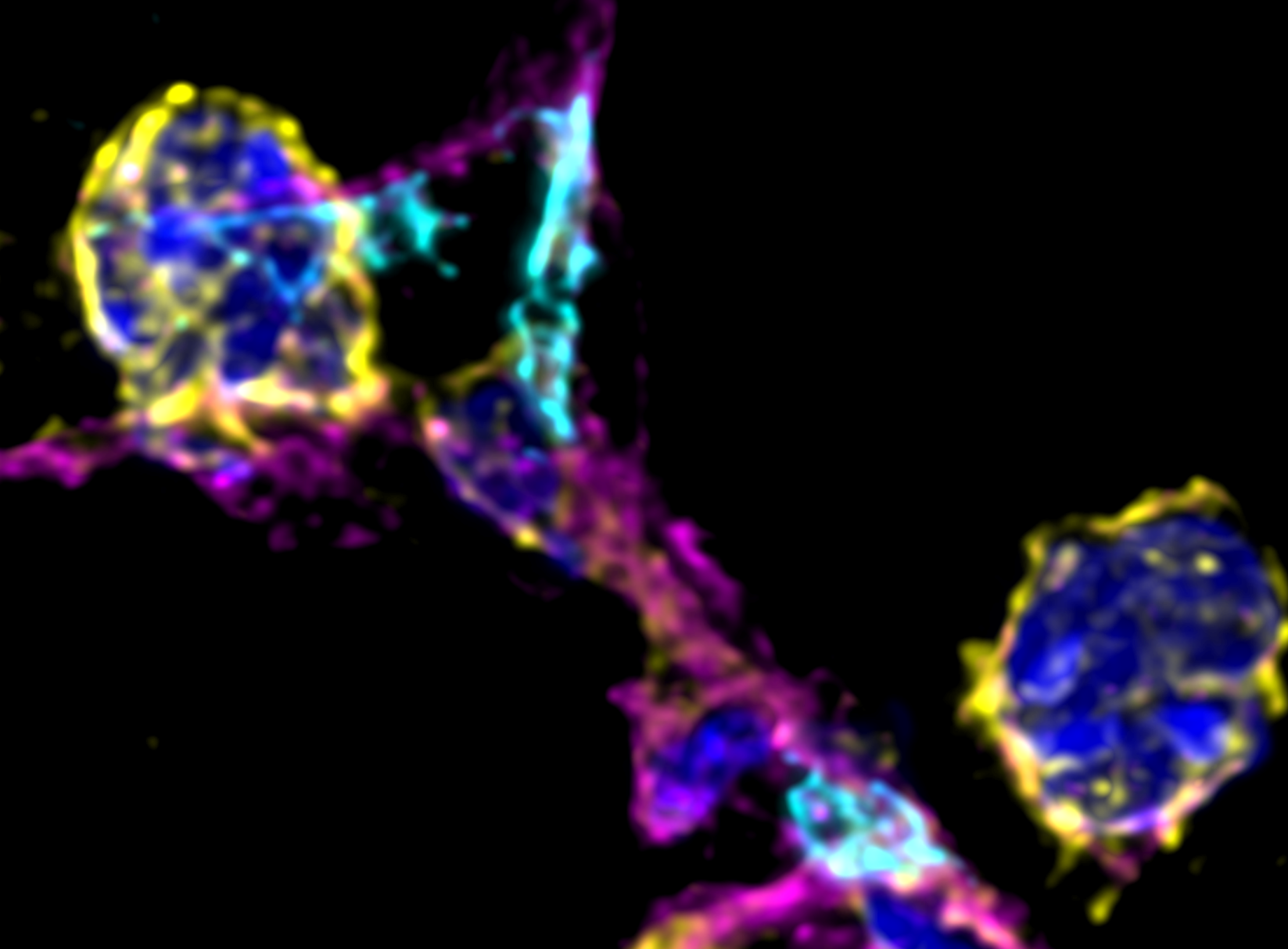Erinnert sich noch jemand an die erste Phase der Corona-Pandemie im Jahr 2020? Als Geschäfte, Restaurants, Kinos und Theater geschlossen blieben. Als Treffen mit Freunden und Verwandten untersagt waren. Als der Schulunterricht ins heimische Kinderzimmer verlegt wurde. Als Verreisen undenkbar war.
Aktuell sieht es so aus, als sei diese Zeit von den meisten Menschen längst vergessen. Dabei dürften die verschiedenen Corona-Maßnahmen der Politik bei vielen für enormen Stress gesorgt haben. Die Angst um den Arbeitsplatz, die Sorge um erkrankte Verwandte, die nervliche Belastung, wenn Eltern und Kinder zusammen in einer kleinen Wohnung sitzen und Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen sollen: Das alles ist nicht ohne Auswirkungen geblieben, wie zahlreiche Studien zeigen.
Angst ist der zentrale Faktor
Inwieweit sich diese Erfahrungen auf die psychische Gesundheit und die Lebensqualität von Frauen und Männern im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie ausgewirkt haben: Das hat ein Forschungsteam der Würzburger Universitätsmedizin untersucht. Konkret haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür interessiert, in welchem Verhältnis Sorgen um den Arbeitsplatz und um andere Menschen mit eigenen psychischen Problemen wie Angst und Depression und der Lebensqualität allgemein stehen, welchen Einfluss die Unterstützung im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz darauf hat – und: ob es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt.
Klares Ergebnis: In diesem Netzwerk unterschiedlicher Variablen und Einflussfaktoren steht Angst absolut im Mittelpunkt. Dabei zeigen sich allerdings eindeutige geschlechtsspezifische Unterschiede: „Bei Männern steigt die Angst in zunehmenden Maß mit der Sorge um den Arbeitsplatz, bei Frauen findet sich dieser Effekt nicht. Dafür konnten wir bei Frauen eine Zunahme der Angstwerte parallel mit einer Zunahme der Sorgen um Familie und Freunde registrieren“, sagt Grit Hein. Zusätzlich zeigt die Studie, dass Frauen positiv auf die Unterstützung durch Freunde und Familie in solchen Zeiten reagieren, indem sie ein Plus an Lebensqualität empfinden. Bei Männern zeigte sich dieses Phänomen nicht.
Daten über den Einfluss des Geschlechts fehlten
Grit Hein ist Professorin für Translationale Soziale Neurowissenschaften an der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Würzburger Universitätsklinikums. Gemeinsam mit ihrem Postdoc Martin Weiß hat sie die Studie geleitet, deren Ergebnisse jetzt in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurden.
„In der Vergangenheit haben zahlreiche Studien untersucht, welchen Einfluss psychosoziale Faktoren wie beispielsweise die Unterstützung durch Freunde und Kollegen und finanzielle, berufliche oder persönliche Sorgen auf die psychische Gesundheit und die Lebensqualität ausüben. Es fehlten jedoch Daten darüber, ob diese Zusammenhänge bei Männern und Frauen gleich sind“, erklärt Grit Hein den Hintergrund der Studie. In einer Erweiterung früherer Untersuchungen hat das Würzburger Forschungsteam deshalb jetzt den Einfluss dieser Faktoren in Abhängigkeit vom Geschlecht untersucht.
Studie mit rund 2.900 Teilnehmenden
Die entsprechenden Informationen bekam das Team von einer großen Gruppe von Probandinnen und Probanden geliefert: den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der sogenannten STAAB-Studie. Diese umfasst eine Kohorte von rund 5.000 zufällig ausgewählten Freiwilligen aus der Allgemeinbevölkerung Würzburgs und richtet ihren Fokus eigentlich auf die Entwicklung von Herzkreislauferkrankungen. Während der COVID-19-Pandemie wurde das Programm spontan auf die psychosozialen Auswirkungen von Pandemie, Lockdown und anderen Begleiterscheinungen erweitert.
Insgesamt haben sich 2.890 Menschen, 1.520 Frauen und 1.370 Männer, an der Umfrage beteiligt. Ihr Alter lag zwischen 34 und 85 Jahren, das Durchschnittsalter betrug 60 Jahre. Sie mussten zwischen Juni und Oktober 2020 einen umfangreichen Fragebogen zu ihrem psychischen Befinden ausfüllen. Unter anderem sollten sie Auskunft darüber geben, wie stark sie sich von ihrem sozialen Umfeld, ihren Kollegen und Vorgesetzten unterstützt fühlten und ob sie jemanden hatten, mit dem sie ihre Probleme besprechen konnten. Gefragt wurde auch, inwieweit Kontaktverbote zu Eltern und Großeltern sie belasteten und wie groß der Stress am Arbeitsplatz oder in der Schule war. Finanzielle Probleme oder die Sorgen darum waren Gegenstand weiterer Fragen.
Bei der Auswertung der Daten setzten Hein und ihr Team auf eine besondere Methode: die sogenannte Netzwerkanalyse. „Analysen, die auf einem Netzwerkansatz basieren, ermöglichen eine grafische Darstellung aller Variablen als einzelner Knotenpunkte“, erläutert Hein. Auf diese Weise sei es möglich, Variablen zu identifizieren, die in besonderem Maße mit anderen Variablen verbunden sind. Das Netzwerk könne somit beispielsweise komplexe Beziehungen zwischen Symptomen verschiedener psychischer Störungen aufzeigen und damit eventuelle Komorbiditäten erklären.
Ergebnisse passen zu traditionellen Geschlechternormen
Wirklich überrascht von den Ergebnissen waren Grit Hein und Martin Weiß nicht. „Die Beobachtung, dass Männer stärker mit der Arbeit und Frauen stärker mit Familie und Freunden in Verbindung gebracht werden, kann auf traditionelle Geschlechternormen und -rollen zurückgeführt werden“, erklärt Hein. Demnach fühlen sich Männer in der Regel stärker von Arbeitsplatzunsicherheit und Arbeitslosigkeit betroffen, was zu einer höheren psychischen Belastung führt. Frauen empfinden hingegen eine höhere Belastung, wenn sie das Gefühl haben, ihre Familie zu vernachlässigen.
Dass es Frauen psychisch besser geht, wenn sie Unterstützung durch Freunde und Familie erfahren, liege ebenfalls auf der Hand: „Dies steht im Einklang mit der traditionellen weiblichen Familienrolle, die eine stärkere Tendenz zu engen sozialen Kontakten und zur Suche nach sozialer Unterstützung beinhaltet, um Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu steigern“, sagt Hein.
Auch wenn diese Ergebnisse eindeutig sind, weisen die Verantwortlichen auf eine Reihe von Einschränkungen hin. Die wichtigste darunter: „Da die COVID-19-Pandemie einen sehr spezifischen Kontext darstellte, muss noch geklärt werden, ob unsere Ergebnisse auf allgemeine pandemieunabhängige Situationen übertragbar sind.“ Unbestreitbar sei jedoch ein Befund: „Unsere Ergebnisse unterstreichen, wie wichtig es ist, bei therapeutischen Maßnahmen soziale Aspekte zu berücksichtigen, um die psychische Gesundheit von Frauen und Männern zu verbessern.“
Originalpublikation
Weiß, M., Gründahl, M., Deckert, J. et al. Differential network interactions between psychosocial factors, mental health, and health-related quality of life in women and men. Scientific Reports 13, 11642 (2023). doi.org/10.1038/s41598-023-38525-8
Kontakt
Prof. Grit Hein, PhD, Professur für Translationale Soziale Neurowissenschaften, Universität und Universitätsklinikum Würzburg, T: +49 931 201-77411, hein_g@ukw.de
Von Gunnar Bartsch