

Marah Alsalkini und Dr. Vera Nickl, MSc., MHBA
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik
Was wir als Kinder werden wollten
Marah Alsalkini: Ich habe ständig meine Meinung geändert. Mal wollte ich Malerin werden, dann Konditorin, dann Ingenieurin, wie mein Vater und meine Geschwister. Ich wollte immer etwas Neues entwickeln, bis zur Perfektion. Durch den Krieg bin ich zur Medizin gekommen. Meine Heimatstadt stand vor allem zu Beginn des Bürgerkriegs unter Dauerbeschuss. Beim Anblick der vielen Verletzten hatte ich meinen Berufswunsch klar vor Augen: Ich wollte etwas Humanitäres und Wertvolles tun, Leben retten oder zumindest verbessern, und das bis an mein Lebensende. Nach dem Abitur habe ich an einem Workshop teilgenommen, bei dem man in verschiedene Bereiche hineinschnuppern konnte. Dabei wurde mir klar, dass ich mich nirgendwo anders als in der Medizin sehe. Ich wollte Ärztin und Chirurgin werden. Zum Glück hat mich meine Familie immer unterstützt.
Vera Nickl: Ich wollte immer Tierärztin werden. Als ich die Illusion von der ländlichen Idylle dieses Berufes verlor und merkte, dass man als Tierärztin auch in Massentierhaltungen arbeiten muss, wechselte ich zur Humanmedizin. Da ich unbedingt in Würzburg studieren wollte und dafür ein 1,0-Abitur brauchte, habe ich mich mächtig angestrengt. Hätte es nicht geklappt, wäre ich wie meine Oma Krankenschwester geworden. Hauptsache Medizin! Das Soziale ist mir wohl in die Wiege gelegt worden. Meine Mutter arbeitet auch in einem sozialen Beruf. Der Wunsch, zu helfen, ist bei uns allen sehr ausgeprägt.
Warum gerade Würzburg und die Neurochirurgie?
Marah Alsalkini: Mich hat schon immer die abwechslungsreiche und strukturierte Arbeit an einer Universitätsklinik fasziniert, da man klinische und akademische Arbeit gut verbinden kann. Würzburg hat eine lange Geschichte in der Wissenschaft, und die Universitätsmedizin in Würzburg ist für mich optimal, die Forschung hat einen ausgezeichneten Ruf. Zudem hat mich das Glioblastom-Projekt hier besonders begeistert. Mein damaliger Verlobter und heutiger Ehemann hat in Würzburg den Masterstudiengang Translational Neuroscience absolviert und promoviert nun auf dem Gebiet der Tiefen Hirnstimulation. Also habe ich mich bei der Graduate School of Life Sciences beworben – mit Erfolg!
Vera Nickl: Die Neurochirurgie und ich, das war Liebe auf den ersten Blick. Und daran hat sich seit dem fünften Semester, als ich hier mein erstes kombiniertes Praktikum in Klinik und Forschung absolvierte, nichts geändert. Eigentlich wollte ich immer in die weite Welt hinaus. Das habe ich in Etappen auch gemacht. Die Entscheidung, in Würzburg zu bleiben, habe ich jedoch nicht aus Bequemlichkeit getroffen, sondern weil ich von der Neurochirurgie in Würzburg so begeistert war und bin. Die Klinik ist übrigens die älteste selbständige neurochirurgische Abteilung in Deutschland – gegründet 1934 – und bietet ein breites Spektrum an klinischen Schwerpunkten. Unsere Sektion Experimentelle Neurochirurgie ist herausragend!
Was ist das Faszinierende an der Neurochirurgie?
Vera Nickl: Ich finde es sehr spannend, das Gehirn zu benutzen, um es zu verstehen. Das klingt erst einmal paradox, unlösbar. Aber das ist ja gerade das Faszinierende. Außerdem gibt es in der Neurochirurgie alles: Alte und junge Patientinnen und Patienten, Notfälle und Krankheitsbilder, bei denen man sich viel Zeit nehmen und überlegt vorgehen muss. Zudem ist das Team hier einfach klasse. Mit vielen Kolleginnen und Kollegen bin ich befreundet, mit einem bin ich sogar verheiratet.
Marah Alsalkini: In den Anfangsjahren meines Medizinstudiums entwickelte sich mein Interesse an der Neurochirurgie. Dies wurde maßgeblich durch den direkten Kontakt mit neurochirurgischen Patientinnen und Patienten und ihren komplexen Fällen beeinflusst. Während meiner Promotion und einer dreimonatigen Hospitation in der Klinik hatte ich die Gelegenheit, mein Verständnis für dieses Fachgebiet weiter zu vertiefen. Diese Erfahrungen haben meine Überzeugung gestärkt.
Unser Forschungsgebiet
Marah Alsalkini: Während unsere beiden Männer im Bereich der Tiefen Hirnstimulation forschen, beschäftigen wir Frauen uns mit dem Glioblastom. Das Glioblastom ist der häufigste und aggressivste Hirntumor, der Menschen jeden Alters befällt. Unser Traum ist es, mit neuen Therapieansätzen das Überleben der Patientinnen und Patienten zumindest verlängern zu können.
Vera Nickl: Dazu erstellen wir in meiner Arbeitsgruppe Organoid-Modelle. Da das Glioblastom sehr komplex ist, kann es in herkömmlichen Zellkultursystemen nicht exakt nachgeahmt werden. Mit 3D-Organoiden, die wir aus dem Gewebe unserer Patientinnen und Patienten herstellen, können wir die heterogenen Eigenschaften des Glioblastoms und seines Tumormikromilieus dagegen sehr gut nachbilden. Das heißt: Wir bauen ein Modell des ursprünglichen Tumors, um seine Eigenschaften zu erforschen und neue Therapieansätze zu testen. Am UKW arbeiten wir unter andere m in einem vom Interdisziplinären Zentrum für Klinische Forschung (IZKF) und Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZKF) geförderten Projekt eng mit Priv.-Doz. Dr. Thomas Nerreter vom Hudecek-Lab zusammen.
Marah Alsalkini: Gerade haben wir eine innovative Methode zur Erzeugung von 3D-Organoiden unter Verwendung eines automatisierten Gewebeschneiders eingeführt. Das Methodenpapier wurde im JoVe-Journal veröffentlicht.
Vera Nickl: Ich konnte nicht mehr mit ansehen, wie Marah stundenlang im Labor saß und Organoide geschnitten hat. Durch das Pingpong-Spiel mit unseren Ideen sind wir zügig in unserem Projekt vorangekommen. Die neue Methode ist vor allem Marahs Initiative zu verdanken.
Marah Alsalkini: Mit unserer automatisierten Methode konnten wir die Produktionszeit um fast 70 Prozent verkürzen und die Anzahl der Gewebe-Quader im Vergleich zur manuellen Zerlegung deutlich erhöhen. Indem wir den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Herstellung von Organoiden verringert haben, konnten wir auch die Durchführbarkeit eines Screenings von Medikamenten und Immuntherapien verbessern.
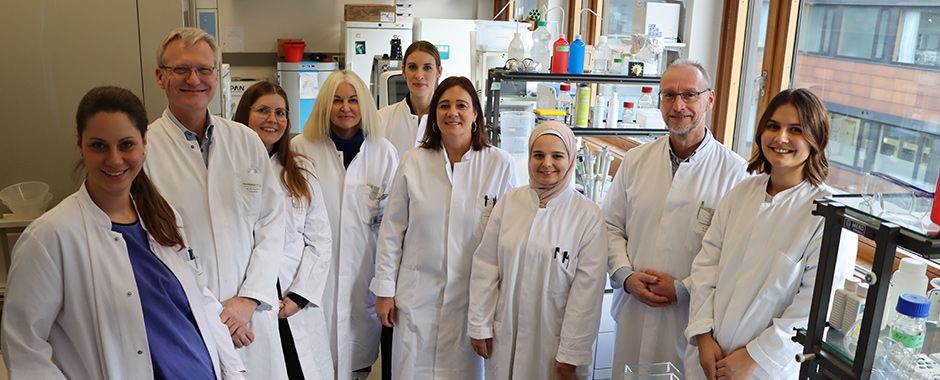
Fruchtbare Zusammenarbeit
Vera Nickl: In unserem Team läuft die Zusammenarbeit wie ein Perpetuum Mobile. Es macht große Freude, Marah bei ihrer Doktorarbeit zu betreuen. Nachdem sie im Labor angekommen ist, sich orientiert hat, die Methoden und Inhalte kennengelernt und verstanden hat, sprudelten die Ideen förmlich aus ihr heraus.
Marah Alsalkini: Vera hat mich aber auch immer in allem unterstützt. Der Anfang hier in Deutschland war nicht leicht. Aber in Vera sah ich die junge Ärztin mit großen Träumen, die sie mit großem Engagement verfolgt und die mit Begeisterung arbeitet.

Ärztin und / oder Wissenschaftlerin? – Die Arbeit als Clinician Scientist
Vera Nickl: Wenn mich jemand fragt, bist du Ärztin oder Wissenschaftlerin? Ich könnte mich nicht entscheiden. Ich liebe beide Tätigkeiten gleichermaßen und mache beides mit Herzblut. Seit Januar 2018 arbeite ich als Assistenzärztin am UKW. Das Clinician Scientist Programm des IZKF ermöglichte mir dann 2019 den Einstieg in die Forschung. Das klingt von außen vielleicht sehr anstrengend. Aber da sich Wissenschaft und Klinik so gut die Waage halten und die Tätigkeiten sich auch ausgleichen, fehlt es mir an nichts. Entspannung finde ich bei meiner Familie, in der Natur, im Wald und unter Wasser beim Tauchen sowie auf Reisen.
Marah Alsalkini: Clinician Scientists gibt es in Syrien leider nicht. Es ist toll, dass ich in Deutschland beide Seiten kennenlernen kann, da beide stark miteinander verbunden sind: Unsere ärztliche Arbeit basiert auf der Forschung, aber man muss dazwischen immer balancieren.
Faszination Forschung
Vera Nickl: Das Faszinierende an der Wissenschaft sind die Wendungen, denen man folgt. Man beginnt nicht mit einer vorgefassten Meinung, sondern mit einer gewissen Neugier. Wie kann man verschiedene Therapien so kombinieren, dass Synergieeffekte entstehen? Wenn etwas nicht funktioniert, ist die Frage, ob es wirklich nicht funktioniert hat oder ob es einfach nicht das Ergebnis ist, das wir uns vorgestellt haben und wir umdenken müssen.
Marah Alsalkini: Ich bin glücklich, wenn ich Probleme lösen und positive Ergebnisse erzielen kann. Wenn meine Ergebnisse mit denen anderer Forscherinnen und Forscher übereinstimmen, zeigt mir das, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Vera Nickl: Für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich habe meine eigene Arbeitsgruppe. Gerade die Translation ist das Spannende an meinem Beruf, dass ich an der Erkrankung, dem Glioblastom, forsche und parallel die Patientinnen und Patienten sehe, die Indikation stelle, sie therapiere und mit meiner Zusatzausbildung in Palliativmedizin auch auf dem letzten Weg begleite. Wenn ich diese Schicksale verfolge, motiviert mich das unglaublich für die Forschung und treibt mich an. Ich weiß, dass das, was ich hier tue, absolut sinnvoll ist. Denn natürlich möchte ich meine Forschung eines Tages auch zum Patienten bringen. Man kommt in einen Flow. Wenn alles zusammenpasst, ist das ein schönes Gefühl.
Marah Alsalkini: Ja, wenn etwas im Labor theoretisch gut funktioniert, hofft man natürlich, dass man die gleichen Effekte auch in der Klinik sieht. Die Arbeit als Clinician Scientist ist perfekt. In Syrien hatten wir keine experimentelle Forschung, deshalb wollte ich nach Würzburg. Aber auch die klinische Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass ich im März meine Approbation erhalte.
Vera Nickl: In der Klinik sind klare Hierarchien erforderlich, die Aufgaben sind gut strukturiert. In der Forschung herrscht eine ganz andere Arbeitskultur und beide Welten ergänzen sich sehr gut.

Frauen in der Neurochirurgie
Vera Nickl: Die Chirurgie ist ja eigentlich eine Männerdomäne. In der Neurochirurgie sind jedoch verhältnismäßig viele Frauen tätig. Wir haben einige Oberärztinnen und mit Professorin Cordula Matthies eine stellvertretende Direktorin. Vielleicht ist es hier ausgeglichen, weil die Neurochirurgie aufgrund ihrer Komplexität etwas ganz Besonderes ist. Man muss auch mal leise sein, sich zurücknehmen und sehr planvoll vorgehen. In unserer Klinik wird man nicht belohnt, wenn man ein großes Ego hat. Die Neurochirurgie sollte kein Ellbogenfach sein. Und es gibt in der Fülle des Faches immer Neues zu entdecken und zu lernen.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Marah Alsalkini: Wir haben beide noch keine Kinder. Aber wir haben keine Bedenken, dass wir die Familie nicht mit unserem Beruf vereinbaren können. Denn wir haben Männer, die uns verstehen und unterstützen. Wir arbeiten und leben auf Augenhöhe.
Wie kann man den Nachwuchs für die Medizin begeistern
Vera Nickl: Von der Pflege über die technische Assistenz bis hin zum ärztlichen Personal – die Wertschätzung für diese Berufe muss unbedingt steigen, gesellschaftlich und ja, auch monetär. Gerade das Pflegepersonal und die TA leisten eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Ohne sie könnten wir Clinician Scientists weder in der Klinik noch im Labor arbeiten.
Tipp für Frauen
Marah Alsalkini: Frauen sollten mehr Selbstvertrauen haben und sich nicht von Hindernissen oder Schwierigkeiten aufhalten lassen. Alles ist erreichbar. Es geht nicht um das Geschlecht, sondern um Wissen, Ideen und Leistung. Wir müssen mit Stereotypen brechen. Schauen wir nach Syrien: Traditionell haben sich die Frauen um die Kinder gekümmert, was sehr anspruchsvoll ist. Im Krieg wurde den Männern bzw. der Gesellschaft die problematische sozioökonomische Situation bewusst. Man hat erkannt: Wir brauchen die Frauen! In den letzten zehn Jahren ist der Anteil der Frauen in vielen Berufen in Syrien gestiegen. Natürlich gibt es auf dem Land noch viele, die traditionell denken, aber in der Stadt können Frauen alles werden, wenn sie wollen.
Die Kopftuch-Frage
Marah Alsalkini: In Deutschland wird mein Kopftuch respektiert. Die Stadt Würzburg und der Campus sind generell sehr offen und bunt. Mir ist es wichtig zu zeigen, dass Arbeit und Erfolg nicht von der Kleidung abhängen. Das Kopftuch ist für mich kein Zeichen von Unterdrückung oder Benachteiligung. Ich spüre aber einen gewissen Druck, da es bei der Arbeit nur sehr wenige Frauen mit Kopftuch gibt. Ich nehme Gedanken und Erwartungen wahr, dass eine Frau mit Kopftuch in der Neurochirurgie eher ungewöhnlich ist.
Stolpersteine
Vera Nickl: Meine Oma, die Krankenschwester, hat immer gesagt: Man soll die kleinen Steine nicht wegschieben, sondern vorsichtig darüber gehen und sich die Kraft für die großen aufsparen. Das habe ich beherzigt. Aber wirklich große Stolpersteine gab es bei mir nicht, höchstens kleine Pikser: Wenn mich zum Beispiel Patientinnen und Patienten, die ich vorher schon ausgiebig über die Operation aufgeklärt habe, immer noch für eine Krankenschwester halten. Oder wenn sich jemand einen männlichen oder älteren Operateur wünscht.
Meilensteine
Vera Nickl: Was mich fachlich und persönlich weitergebracht hat, waren meine Auslandsaufenthalte. Ich war während des Studiums vier Monate in Nagasaki, habe zwei Monate in Ghana gearbeitet und ein neunmonatiges Forschungspraktikum in Boston, am Lehrkrankenhaus der Harvard Medical School, dem Massachusetts General Hospital, absolviert. Da musste ich meine Komfortzone verlassen und habe viel gelernt. Ein weiterer wissenschaftlicher Meilenstein war, als ich eigene Drittmittel einwerben und eigene Projekte entwickeln konnte.
Unsere Wünsche
Marah Alsalkini: Gesellschaftlich wünsche ich mir Gleichberechtigung, unabhängig von Geschlecht, Nation und Religion. Keiner von uns hat sich ausgesucht, wo er oder sie geboren und aufgewachsen ist.
Vera Nickl: Wir sind bereits so weit gekommen, das freut mich sehr. Aber natürlich ist immer noch Luft nach oben, vieles lässt sich auch nicht durch Vorschriften und Gesetze regeln, zum Beispiel, dass Frauen immer noch den Hauptteil der Care-Arbeit übernehmen. Daher wünsche auch ich mir Gleichberechtigung. Zum Beispiel, dass Erziehungszeiten für Männer nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch gesellschaftlich anerkannt werden. Dass Männer sich trauen, für die Familie beruflich kürzer zu treten und tatsächlich eine Zeit lang Teilzeit zu arbeiten. Weder für Männer noch für Frauen sollte es einen Karriereknick bedeuten, wenn sie eine Zeit lang reduziert arbeiten und sich der Familie widmen. Und generell wünsche ich mir mehr Anerkennung und Respekt für die medizinischen Berufe. Nicht nur die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte, sondern auch die des Pflegepersonals ist unglaublich anstrengend. Wir geben unser Bestes.
