

Prof. Dr. med. Claudia Sommer
Leitende Oberärztin an der Neurologischen Klinik und Schmerzforscherin
Was ich als Kind werden wollte
Ich wollte schon immer forschen, unbedingt. Am interessantesten erschien mir das Nervensystem. Ich entschied mich, über die Medizin zum Feld der Neuroanatomie und Neurophysiologie zukommen. Erst später merkte ich, dass ich auch die Menschen mit den Krankheiten spannend fand: Jede Patientin und jeder Patient ist ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Somit mache ich heute beides, Klinik und Forschung.
Auf der anderen Seite wollte ich wie mein Vater sehr viele Sprachen lernen und damit arbeiten. Doch unterm Strich kann ich meine fünf Fremdsprachen besser als Hobby verfolgen. Und heute freue ich mich, wenn ich beides verbinden kann und zum Beispiel bei einem Schmerzkongress in Spanien meinen Vortrag auf Spanisch halten kann.
Meine drei Forschungs-Highlights
Mich hat immer fasziniert, bei unerklärten Krankheiten, an die vielleicht kaum jemand glaubt, Mechanismen zu entdecken und zu zeigen, dass im Körper tatsächlich etwas passiert, dass wir das Phänomen ernst nehmen.
Das Stiff Person Syndrom ist zum Beispiel eine seltene Autoimmunerkrankung, die wir nie richtig verstanden haben. Warum werden die Betroffenen steif? Wir haben uns eine Patientin ganz genau angeschaut, das Blutserum auseinandergenommen und uns experimentelle Schritte ausgedacht. Und wir konnten tatsächlich zeigen, dass die Antikörper die Neurone angreifen.
Ein anderes Projekt dreht sich um Fibromyalgie, ein chronisches Schmerzsyndrom, das überwiegend Frauen betrifft und von vielen allein auf die Psyche zurückgeführt wird. Mit meiner Kollegin Professorin Nurcan Üçeyler konnten wir erstmals biologische Indikatoren für die Fibromyalgie identifizieren. Ein Beleg dafür, dass auch organisch etwas nicht in Ordnung ist, waren die Zytokine, also die Botenstoffe, die bei einer Reaktion des Immunsystems gebildet werden und die sich auf Entzündungsprozesse im Körper auswirken. Später haben wir festgestellt, dass bei vielen Betroffenen die Anzahl der kleinen Nervenfasern in der Haut reduziert ist. Eine Fibromyalgie hat also nicht nur psychische Ursachen.
Darüber hinaus interessiere ich mich sehr für Autoantikörper, also Antikörper, die gegen körpereigenes gesundes Gewebe gerichtet sind. Ich wollte herausfinden, ob die Ursache einiger Neuropathien, die zur Degeneration der peripheren Nerven und dann zu Muskelschwund führen, mit Autoantikörpern zu tun haben. Also habe ich eine Mitarbeiterin, Kathrin Doppler, davon überzeugt, mit mir dieses Feld zu erforschen. Anfangs lief es sehr stockend. Doch dann haben wir im Mikroskop gesehen, wie sich bei einigen Betroffenen die Autoantikörper an eine ganz spezielle Struktur der Nervenfasern, an die Ranvierschen Schnürringe setzen. Inzwischen hat sich daraus ein ganzes Gebiet entwickelt, auf dem wir uns weltweit einen Namen gemacht haben.
Forscherinnengeist
Es freut mich sehr, dass die gerade erwähnte Autoantikörper-Idee und die Persistenz, bei den ersten Hürden nicht gleich aufzugeben, Erfolg hatten. Kathrin Doppler hat sich inzwischen zu dem Thema habilitiert, und wir konnten viele Gelder und dementsprechend weitere jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für dieses Gebiet anwerben. Ich bin schon stolz, wenn die Menschen, die ich angeleitet habe, selbstständig werden und in der Weltspitze mitforschen.
Ein großer Erfolg aus den letzten Jahren ist zudem die Einwerbung der klinischen Forschergruppe ResolvePAIN mit meiner Kollegin Heike Rittner bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Dass wir zwei Frauen es geschafft haben, in einem sehr kompetitiven Gebiet 7 Millionen Euro einzuwerben, von denen nun zehn Arbeitsgruppen die peripheren Schmerzmechanismen erforschen können, ist wirklich toll. Und auch die Zusammenarbeit mit Heike Rittner macht großen Spaß.
Und natürlich ehrt es mich, dass ich mit meiner Kooperationspartnerin Andrea Kübler vom Lehrstuhl für Psychologie im Research.com-Ranking unter die besten 100 weiblichen Wissenschaftlerinnen in Deutschland und unter den besten 1000 weltweit gelistet wurde.

Warum Mentoring und Netzwerken so wichtig sind
Manchmal bin ich neidisch auf die heutige Generation, die sich teilweise vor Mentoring-Programmen nicht helfen kann. Ich hatte weder fachlich noch persönlich durchgehende Mentoren oder weibliche Vorbilder und gehörte zu Beginn meiner Karriere auch nie einer strukturierten und geförderten AG an. Als ich mit Anfang 30 eine eigene AG gegründet habe, bestand diese aus einer Doktorandin und mir und einer Ecke im Labor, die wir mitbenutzen durften. Das wäre heute nicht mehr konkurrenzfähig. Daher sind die heutigen Förderprogramme wirklich großartig.
Man muss sich zudem davon befreien, als Klinikerin alles selbst machen zu wollen und zu können. Hier in der Universitätsmedizin Würzburg gibt es zum Beispiel hervorragende Grundlagenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die viele Techniken wesentlich besser beherrschen und mir in kniffligen Fragen zur Seite stehen.
Positionen in Fachgesellschaften
Ich war sowohl Präsidentin der Deutschen Schmerzgesellschaft wie auch, bis vor kurzem, der International Association for the Study of Pain. Darüber hinaus bin ich sehr engagiert in der European Academy of Neurology, welche ich auch genutzt habe, um mein Netzwerk zu erweitern, und insbesondere, um anderen Kolleginnen und Kollegen den Zugang zu diesen Netzwerken zu erleichtern.
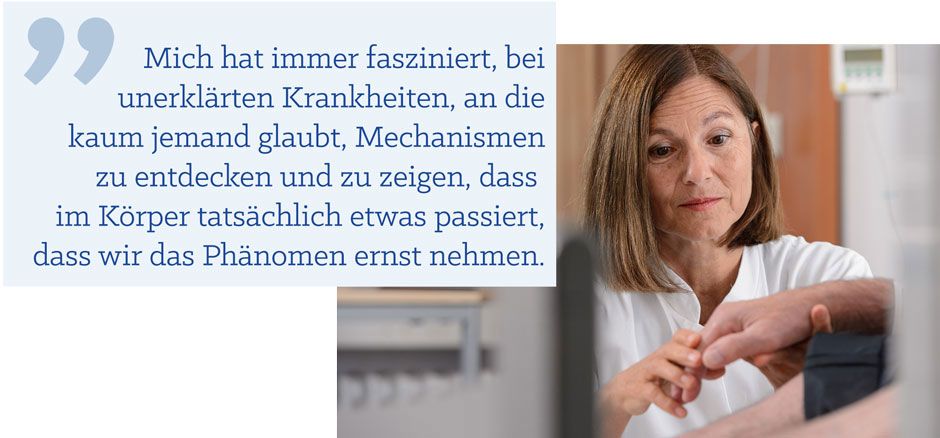
Anreize für mehr Frauen in der Wissenschaft
Ich bin in einer reinen Männerwelt groß geworden. Die Oberärzte waren selbstverständlich männlich, und auch die Konkurrenz bei den Bewerbungen auf Lehrstühle war männlich. Zu den meisten Runden bin ich gar nicht erst eingeladen worden. Heute müssen Frauen eingeladen werden. Und das ist gut so. Jede Universität schmückt sich mit guten Professorinnen. Doch die sind immer noch selten. Es gibt nicht genügend habilitierte Frauen. Daher müssen wir vor allem ganz junge Frauen fördern. Leider gibt es sowohl für Frauen als auch für Männer immer noch keine gute Lösung dafür, eine Doppelkarriere in Klinik und Forschung aufrechtzuhalten und dies noch mit einer eigenen Familie zu verbinden.
Wie wir Nachwuchs fördern
Die Motivation muss von innen kommen, wenn sie von außen aufgesetzt wird, ist das Quälerei. Wir können aber die Motivation wecken. Zum Beispiel mit Kinderuniversitäten, wo mit einfachen und schönen Worten gezeigt wird, wie spannend Forschung sein kann.
Was mich motiviert
Für mich gilt: Bloß keine Langeweile aufkommen lassen. Etwas untersuchen zu dürfen, einer Sache auf die Spur zu kommen, das hält mein Leben spannend. Mit begabten und motivierten jungen Leuten arbeiten zu dürfen ist zudem ein großes Geschenk.
Meine Wünsche für die Zukunft
Ich wünsche mir für die Gesellschaft, dass es mehr Demokratien gibt, die in Frieden miteinander leben. Denn das tun Demokratien üblicherweise. Für die Medizin wünsche ich mir, dass wir endlich Krebs heilen können, der viel zu viele Menschen in zu jungem Alter umbringt. Viele Mechanismen sind ja schon gut bekannt, und für einige Krebsarten sind schon sehr intelligente Behandlungsformen gefunden worden. Natürlich wünsche ich mir als Schmerzforscherin auch bessere Wege, Schmerzen zu lindern, besonders im Bereich der chronischen Schmerzen, aber da sind wir ja selbst gefragt. Persönlich möchte ich auch in den nächsten Jahren noch an spannenden Inhalten forschen dürfen, in freundschaftlicher Kooperation mit motivierten Gleichgesinnten.
