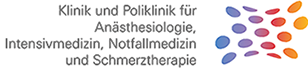Interview von Jaonas Strehl
SZ: Im Februar steuerte in München ein Mann sein Auto in eine Demonstration, im Januar hat einer in Aschaffenburg eine Kindergartengruppe angegriffen. Es starben Menschen. Kann man auf solche Situationen überhaupt vorbereitet sein?
Wurmb: In gewisser Weise schon. Man kann die Prinzipien trainieren, wie man darauf reagiert. Das haben wir mit den Anschlägen 2016 und 2021 hier in Würzburg gelernt.
Im Juli 2016 hatte ein Mann in einer Regionalbahn bei Würzburg vier Menschen mit einer Axt und einem Messer lebensbedrohlich verletzt, eine weitere Frau verletzte er auf der Flucht schwer.
Dass jemand als Terroranschlag mit einer Axt und einem Messer auf Leute einschlägt und sticht, das kannten wir in Würzburg zuvor nicht. Das erfordert eine ganz andere Einsatztaktik, die noch nicht ausgereift war. Wir gingen damals mit einer Taktik in den Einsatz, die für zivile Lagen passt, für einen Verkehrsunfall etwa, aber nicht für einen aktiven Täter, der um sich sticht und vor dem man sich auch selbst schützen muss. Das fing bei den Begrifflichkeiten an: Solche Einsätze werden heute als „lebensbedrohliche Einsatzlage“ bezeichnet. Damit weiß jeder, was los ist. Vor zehn Jahren gab es den Begriff nicht. Fast zwei Jahre lang haben wir den Einsatz wissenschaftlich aufgearbeitet und unsere Konzepte angepasst.
Fünf Jahre später erstach in der Würzburger Innenstadt ein Mann drei Frauen und verletzte neun Menschen.
Da hatten wir einen fast identischen Einsatz mit vielen Einsatzkräften, die 2016 schon dabei waren, und waren vorbereitet: Die Ausrüstung des Rettungsdienstes war auf typische Stich- und Schussverletzungen angepasst, die Zusammenarbeit mit der Polizei war klar und die Patienten konnten viel schneller abtransportiert werden. In letzter Konsequenz ist man leider nie gänzlich vorbereitet, weil solche Angriffe immer unerwartet und dynamisch sind und mit unvorstellbarer Brutalität ausgeführt werden. Aber wir sind auf einem guten Weg. Das System wird besser und wir werden besser.
Funktioniert das immer, dass man aus vergangenen Katastrophen lernt?
Nein. Wir haben viele Anschläge weltweit wissenschaftlich ausgewertet und festgestellt, dass man nach den verschiedenen Angriffen immer zu den gleichen Erkenntnissen kam. Es sieht so aus, als würden wir nicht ausreichend voneinander lernen. Es ist einfach noch nichts getan, wenn man nur rausfindet, dass beispielsweise die Kommunikation nicht funktioniert hat. Die Erkenntnisse müssen umgesetzt und bis zur Einsatzkraft durchdekliniert werden.
Um junge Medizin-Studierende auf solche Ausnahmesituation vorzubereiten, haben Sie am Uniklinikum Würzburg das Wahlfach „Katastrophenmedizin“ initiiert. Um welche Katastrophen geht es in dem Wahlfach?
Die Definition einer Katastrophe ist recht spezifisch, darunter fallen Sturzfluten oder Erdbeben, aber auch Terroranschläge und Flugzeugabstürze. Auch eine Reihe von Großschadenslagen, wie ein Busunfall, erfordern Elemente der Katastrophenbewältigung. Wir lehren also nicht die Katastrophe, sondern die Werkzeuge, um sie zu bewältigen. Wenn man die nicht beherrscht, kriegt man das Chaos nicht sortiert.
Was macht eine Katastrophe aus?
Das Entscheidende ist der Ressourcenmangel: Entweder gibt es zu wenig Personal, zu wenig Material oder keine Möglichkeit, beides einzusetzen. Dann muss man die Mittel so verwenden, dass möglichst viele gerettet werden. Der einzelne Patient spielt dann nicht mehr die entscheidende Rolle. Mit dem Wahlfach wollen wir die Studierenden sensibilisieren: Dass sie als Ärztinnen und Ärzte in Katastrophenlagen Entscheidungsträger sind und Situationen erleben, die weit weg vom Alltag sind. Außerdem sollen sie wichtige Werkzeuge lernen, wie das Sichten von Patienten und das Versorgen typischer Verletzungen.
Wie entscheidet man, wem man in so einem Moment hilft?
Das ist in Deutschland seit der Corona-Pandemie ein schwieriges Thema. Wichtig ist bei dieser Art der Sichtung, im Unterschied zu einer Pandemie, dass noch kein Verletzter eine Behandlung bekommen hat. In einer solchen Lage, zum Beispiel nach einem Terroranschlag, muss man also nicht entscheiden, ob man dem einem eine Therapie entzieht, um einem anderen zu helfen. Stattdessen haben wir hier eine sogenannte Ex-Ante-Triage: Man kommt zum Einsatzort, hat vielleicht 100 Verletzte, aber nur zwei Rettungswagen. Um herauszufinden, ob ein Patient lebensbedrohlich verletzt ist, gibt es eine kurze Abfolge strukturierter Fragen. Wer nicht mehr atmet oder stark blutet, bekommt die Sichtungskategorie rot und muss sofort behandelt werden. Wer schwer verletzt ist, aber es noch mal eine Stunde schafft, erhält die Kategorie gelb. Wer noch laufen kann oder nur einen verdrehten Knöchel hat, ist grün. Da würden wir sagen: Sammelt euch alle und dann schauen wir nachher nach euch.
Nun könnte es sein, dass man eine schwerverletzte ältere Person und ein weniger schwer verletztes Kind vorfindet. Spielen dann nur die prüfbaren Parameter eine Rolle?
Hautfarbe, Geschlecht, Orientierung, Alter und Ähnliches spielen in einer Sichtung keine Rolle. Es geht nur um die Einschätzung der medizinischen Dringlichkeit. Aber klar, zum Beispiel nach einem Erdbeben steht man als Einsatzkraft vor einem Dilemma: Man will bestmöglich helfen und kann doch nie genug tun.
Wie bleibt man in so einer Situation ruhig?
Ein wesentlicher Faktor ist die Ausbildung. Wenn man sich schon mal in einer Übung mit solchen Situationen auseinandergesetzt hat, kann man die Mechanismen leichter abrufen. Entscheidend ist auch, wie man zum Einsatz gekommen ist. Wenn man sich als Katastrophenschutzeinheit in ein Gebiet begibt, hat man eine längere Fahrt und kann sich dabei gedanklich vorbereiten und einen Schutz aufbauen. Als Notarzt hat man während der Anfahrt wenigstens zehn Minuten Zeit. Vielleicht lautete die Einsatzmeldung Schlägerei, dabei ist es ein Terroranschlag. Da muss man sich erstmal sortieren.
Was macht das mit einer Person, ständig Katastrophensituationen zu erleben?
Das sind zum Glück in Deutschland keine alltäglichen Einsätze. Klar, als Notfallmediziner erfährt man viel Leid, dem man aber auch etwas Positives entgegensetzen kann. Wenn man das eine Zeit lang macht, belasten die meisten Einsätze auch nicht, sondern werden zur Routine. Dann hilft man Menschen in Not, ohne die Not zu seiner eigenen zu machen.
Und wenn sie doch belasten?
Es ist keine Schande mehr, sich deswegen Hilfe zu suchen. Das ist geübte Praxis, wir stellen Angebote, um posttraumatische Belastungsstörungen frühzeitig zu verhindern. Es gibt aber auch Einsatzkräfte, die mit schlimmen Situationen gut zurechtkommen. Denen darf man nicht einreden, dass sie völlig am Boden zerstört sein müssten.
Muss man ein bestimmter Typ Mensch sein, um als Katastrophenmediziner zu arbeiten?
Es gibt natürlich Menschen, die sich dafür eignen, weil sie improvisieren können, eine stabile Persönlichkeit haben und bereit sind, sich sowas auszusetzen. Aber nein, einen bestimmten Persönlichkeitstyp gibt es nicht. Wer sich damit auseinandersetzen will, der kann das aus meiner Sicht auch.
Was kann man als Einzelner tun, um Einsatzkräfte in einer Krise zu unterstützen?
Man kann sich als Bevölkerung im Kleinen vorbereiten. Bei einer flächigen Katastrophe sind die Katastrophenschutzeinheiten davon abhängig, dass Menschen sich für eine gewisse Zeit selbst helfen können: dass kleinere Verletzungen verbunden werden können, dass Leute Wasser und Essen für drei bis vier Tage haben und sich in der Nachbarschaft unterstützen. Argwohn ist hier fehl am Platz, Vorbereitung muss etwas Selbstverständliches sein. Wenn die Katastrophe dann nicht eintritt: ist doch gut. Dann haben wir den Regenschirm nicht gebraucht, ihn aber dabeigehabt.
„Man will bestmöglich helfen und kann doch nie genug tun.“
Rettungskräfte müssen in Krisen richtig reagieren, wie in München vor einigen Wochen, als ein Mann sein Auto in eine Demonstration lenkte.
Thomas Wurmb, 55, leitet die Notfall- und Katastrophenmedizin am Uniklinikum Würzburg und schuf dort das Fach „Katastrophenmedizin“. Zudem berät der Anästhesist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz.
Foto: Uniklinikum Würzburg
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de