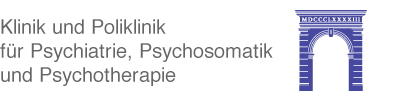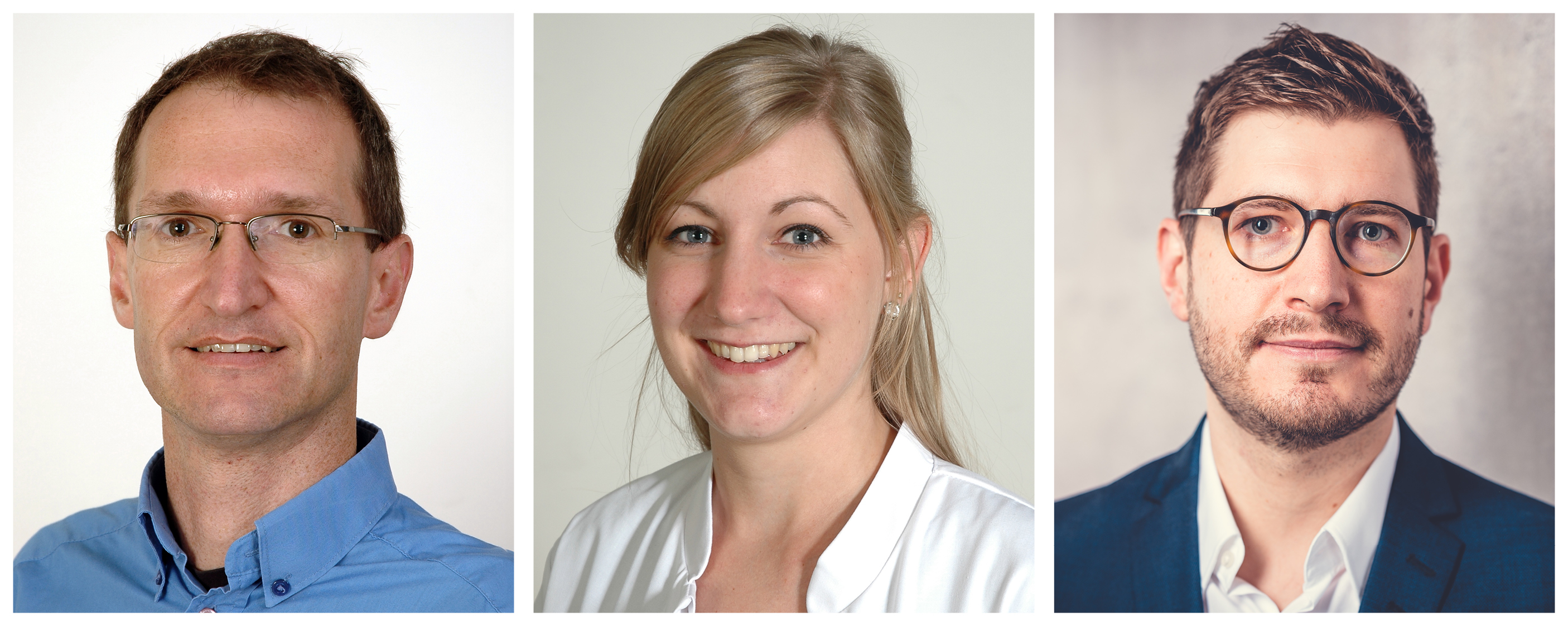Würzburg. Viele Menschen mit chronischen Rückenschmerzen nehmen eine medizinische Rehabilitation gar nicht oder erst zu spät in Anspruch. Das beeinträchtigt die Chancen, das Fortschreiten der Krankheit rechtzeitig einzudämmen. Hier will das Projekt „Zugangsoptimierte Arbeitsfähigkeitsorientierte Rehabilitation“ (ZAR) jetzt mit den Möglichkeiten der Digitalisierung gegensteuern. Hinter dem seit 2021 laufenden Vorhaben stehen die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern und die Krankenkasse AOK Bayern. Von Seiten der Wissenschaft sind das Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung an der Universität Ulm sowie die am Zentrum für Psychische Gesundheit des Uniklinikums Würzburg (UKW) angesiedelte Arbeitsgruppe Rehabilitationswissenschaften beteiligt.
Algorithmus wertet Routine-Daten aus
Ein Kernpunkt des Projekts ist das Zusammenführen und die Interpretation von ansonsten getrennt vorgehaltenen Datensammlungen. Prof. Dr. Heiner Vogel, der Leiter der Würzburger Arbeitsgruppe, erläutert: „Die Krankenkassen haben umfangreiche Informationen über den Krankheitsverlauf ihrer Versicherten und die durchgeführten Therapiemaßnahmen. Sie haben allerdings keine Infos über das letztendliche Ergebnis, wie zum Beispiel eine Frühberentung der Betroffenen. Dieses Wissen hat jedoch die Rentenversicherung.“ Im Projekt ZAR werden diese beiden Datenschätze pseudonymisiert – also unter strenger Beibehaltung des Datenschutzes – miteinander verbunden und interpretiert. Die Auswertung von Routine-Daten wie Diagnosen, Arbeitsunfähigkeitszeiten und Medikamentenverordnungen übernimmt ein spezieller, vom Ulmer Institut entwickelter Algorithmus.
Hochgradig proaktiver, präventiver Ansatz
Das Programm ermittelt proaktiv Menschen mit Reha-Bedarf, denen die AOK Bayern dann frühzeitig ein individuelles Angebot machen kann. Das Verfahren bietet zudem den Vorteil, dass die Rentenversicherung Nordbayern durch die analysierten Daten den Reha-Bedarf schnell erkennen und damit den Antrag zügig bewilligen kann. Um Teilnehmende für das Projekt sowie eine Kontrollgruppe zu gewinnen, schreibt die Krankenkasse derzeit rund 1.000 Versicherte aus Nordbayern an. Die Teilnahme ist freiwillig und nur mit schriftlicher Zustimmung der Versicherten möglich.
Wissenschaftliche Evaluation am UKW
Prof. Vogel und sein Team haben die Aufgabe, das Vorhaben wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren. Dabei geht es um Fragen wie: Haben die Patientinnen und Patienten, die über den Algorithmus in die Reha geschickt werden, im Durchschnitt einen besseren Verlauf? Welche sonstigen Vorteile gibt es gegenüber dem traditionellen Verfahren? Auch die medizinisch-therapeutische Seite wird von den Forscherinnen und Forschern in den Blick genommen: Wie erleben die Behandelnden das „neue“ Patientenklientel, deren gesundheitlichen Probleme vielleicht (noch) gar nicht so gravierend sind, wie bislang gewohnt? „Sollten sich die erwarteten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Vorteile bestätigen, gehört zu den Zielen von ZAR auch die Verstetigung, also die Übernahme in das reguläre Leistungsangebot der Krankenkasse“, berichtet Prof. Vogel und fährt fort: „Dazu entwickeln wir Handlungsanweisungen, bei denen es nicht zuletzt um die richtige Kommunikation mit Menschen geht, die dem Einsatz eines Algorithmus zunächst mit Misstrauen begegnen.“
Das vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte Projekt läuft bis Ende Oktober 2026 und beschränkt sich zunächst auf chronische Rückenbeschwerden. Langfristig ist eine Ausweitung auf weitere Diagnosen möglich.
Texte: Pressestelle UKW